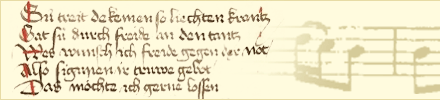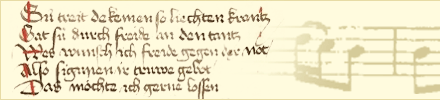Dmitrij Schostakowitsch
(1906-1975)
Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 2 e-Moll op. 67
Andante - Moderato – Poco piu mosso
Allegro non troppo
Largo
attacca: Allegretto – Adagio
Schostakowitschs „nächster Freund und der früheste Verfechter seiner Werke, der einflußreiche Musik-, Theater- und Literaturwissenschaftler Ivan Sollertinski, war am 11. Februar 1944 plötzlich verstorben. Dem Andenken an den geliebten Freund widmete Schostakowitsch sein zweites Klaviertrio op. 67, in dessen vier Sätzen sich die Trauer und der Schmerz um den verlorenen Freund niederschlägt" (T. P. Raphael), aber auch und vor allem die Not und das Unglück seiner Zeit. Uraufgeführt wurde es am 14. November 1944 im bereits befreiten Leningrad.
Angespannte Traurigkeit spricht aus dem Vorspiel des Ersten Satzes, einem Fugato, das mit einem hohen Flagolett des Cellos beginnt:
|
|
Aus dem Fugato entwickelt sich das weitgespannte Hauptthema dieses Satzes, zunächst im Klavier, dann in der Violine. Eigenartig ist dabei die Begleitung durch gleichförmige Achtel im Staccato. Mit dem chromatisch geprägten Zweiten Thema
|
|
beginnt eine erregtere Phase. Bisher gehörte Motive vermischen sich in einem Mittelstück mit Anklängen an Gassenhauer und einem zunächst im Bass des Klaviers eingeführten nahezu obstinaten Motiv (das folgende Beispiel im Diskant des Klaviers):
|
|
Eine gewaltige Steigerung führt hin zum Rückgriff auf das Hauptthema, das nun mit dreifachem Forte zu spielen ist. Der Verlauf wird ruhiger, wenn das obstinate Motiv wieder aufgegriffen wird und das Zweite Thema anklingt. Ein Motiv aus dem Mittelstück klingt an, auch kurz das Zweite Thema. Mit einem polyphonen Spiel einzelner Motive, darunter ein ähnlich obstinates im Cello, klingt der Erste Satz aus.
Der Zweite Satz ist ein Rondo von gewaltsam wirkender Vitalität. Dessen vier Mal wiederkehrendem Thema (=Ritornell, Refrain)
|
|
folgen unterschiedliche Strophen (= Episoden, Couplets): ABACADA. Als Coda wiederholt Schostakowitsch die Episoden B und C (vgl. C.-C. Schuster). Bei der ersten Episode (B) fällt zunächst ein repetierendes 'ais' der Streicher auf, während im Klavier Viertel unisono abwärts steigen. Der Beginn der zweiten Episode (C) überrascht mit einem neuen Klangreiz. Die dritte Episode (D) baut zweimal mit einem gleichbleibenden Ton viel Schwung auf,
|
|
der sich durch absinkende Viertel auflöst.
Der Dritte Satz ist eine ergreifende Passacaglia über acht Akkorde,
|
|
die fünf Mal wiederholt werden und Grundlage sind für einen Klagegesang von Violine und Cello.
Die bei ‚Villa Musica‘ zu findende Bezeichnung ‚Trott‘ für eine eintönige, erschöpfte Bewegung ist sicher keine musikwissenschaftliche Kategorie, entspricht aber gut manchen musikalischen Erscheinungen bei Schostakowitsch, in diesem Fall den Staccato-Achteln am Beginn des Vierten Satzes, die eine passende Begleitung für die hölzern schreitenden Piziccati des Ersten Themas sind:
|
|
Dessen kleine Sekundschritte sind charakteristisch für die ostjüdische Volksmusik. Die barbarische Härte der Begleitung des ebenfalls der jüdischen Volksmusik entnommenen (siehe 8. Streichquartett) Zweiten Themas
|
|
lässt ahnen, was gemeint sein könnte: ein Todesmarsch in ein Konzentrationslager. Ein längeres Zitat sei erlaubt: „Da die Komposition der letzten beiden Sätze des Werkes zeitlich mit dem Erscheinen der ersten Berichte über die Befreiung der Konzentrationslager Belzec, Sobibor, Majdanek und Treblinka zusammenfällt, drängt sich der Gedanke an die apokalyptischen Szenen der Shoa auf. Auch wenn Schostakowitsch diesen Bezug nicht kommentiert hat, besteht wohl kaum ein Zweifel daran, dass es diese Bilder des Grauens waren, die hier musikalische Gestalt angenommen haben: die makabren Klangeffekte – allen voran die hohlen und knöchernen Pizzicati -, die die Grenzen der Erträglichkeit immer wieder verletzende Monotonie, die aus Motivzellen Irrenhauszellen macht.“ (C.-C. Schuster). Es folgt eine variierte Wiederholung des Ersten Themas, dann ein neues, ausdrucksstarkes Thema,
|
|
das sich nach einigen Takten mit dem Ersten Thema verbindet. Im Mittelteil des Satzes werden Motive der ersten beiden Themen neu beleuchtet; zunächst erscheint das Erste in düsterem Licht, dann wird es mit zunehmender Schroffheit durchgeführt: Elemente des Zweiten Themas treten hinzu; alle Motive werden „bis zu hemmungsloser Raserei gesteigert“ (Villa Musica), die formale Regeln zerbricht, Sequenzen werden zum Beispiel ungewöhnlich verlängert. Der dritte Teil eines klassischen Sonatensatzes greift den ersten Teil des Satzes wieder auf. Das geschieht auch hier, aber Schostakowitsch greift auch auf andere Sätze des Trios zurück: bevor die beiden Themen des Vierten Satzes aufgegriffen werden, ist die Fuge des Ersten Satzes mit einer Art Zymbal-Begleitung des Klaviers zu hören, nach den beiden Themen das Passacaglia-Thema. Zweimal noch erklingt in den letzten Takten pianissimo der Beginn des Ersten Themas; ein letztes Mal wird auf unheimliche Weise an die ostjüdische Musik und an das Leid der Juden erinnert.
Dezember 2020
|
 Klavierquintett g-Moll op. 57 / Viola-Sonate op. 147 Klavierquintett g-Moll op. 57 / Viola-Sonate op. 147
|
 |
 |
 |