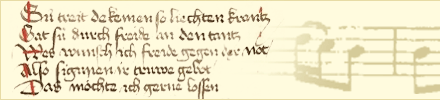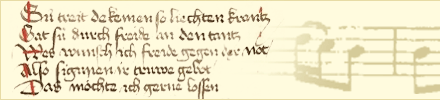|
|

Erinnerungen
Anfänge
|
|
Hochzeit der Eltern am 16. August 1934 in St. Engelbert Köln-Humboldt.
Geboren wurde ich als zweites von zwei Kindern am 20. Juli 1938; 83 Jahre ist das nun her.
Am selben Jahrestag sechs Jahre später: Versuch, Deutschland von Hitler zu befreien.
An Gespräche über diesen Versuch habe ich keine Erinnerung.
Meine erste Erinnerung: Der Bau des Bunkers neben der St.-Engelbert-Kirche.
Der Weg von unserer Wohnung (Rolshoverstraße 166a) zum Schrebergarten führte an dieser Baustelle vorbei. Die Arbeiten dort faszinierten mich so sehr, dass ich nicht von dort fortzukriegen war. Ich sehe mich noch heute wutentbrannt mit dem Fuß aufstampfen. Ich war vielleicht viereinhalb Jahre alt.
So sieht der Bunker heute aus:
|
|
Fliegeralarm I
Es gab am Himmel Leuchtkugeln in Christbäumchenform, die - so vermute ich heute - den Himmel aufhellen sollten zum Abschuss der Bombenflugzeuge. Ich empfand das als Attraktion, meine Eltern wohl auch oder sie taten für mich so.
Vater, von Beruf Küster, Organist und Chorleiter, war zu alt für den Krieg an der Front, er musste stattdessen bei der Feuerwehr aushelfen. Auch von der Feuerwache gibt es Erinnerungen: Vater packte mich unter und glitt vom ersten Stock mit mir die Stahlstange zum Erdgeschoss herunter – mit der Stange ging es in Notfällen schneller. Und einen kleinen Panzer gab es da, in dem ich mitfahren durfte. Das schönste: meine Sammlung von Eisensplittern, die etwa acht Zentimeter lang waren und die Hosentaschen zerrissen. Bei Karl Heinz Bohrer (‚Granatsplitter‘) habe ich gelesen: „Granatsplitter. Das waren aus großer Höhe heruntergefallene Splitter, die von den explodierten Flakgranaten stammten. …Wenn die Flakgranaten kein Flugzeug treffen würden, dürften sie nicht einfach wieder herunterfallen. Deshalb brächte ein Zünder diejenigen, die ihr Ziel verfehlten – und das waren die meisten –, zur Explosion.“ Vaters Kollegen wussten, dass sie mir mit immer neuem Nachschub Freude machen konnten.
Fliegeralarm II
Wenn die Sirenen heulten, ging es runter in den Luftschutzkeller. Durch das Kellerfenster sah ich die Häuser um uns herum brennen. Unser Haus lag etwas zurück; zwischen Haus und Straße gab es Rasen, mit Ligusterhecke abgeschirmt. Die meisten Bomben trafen diesen Rasen statt das Haus; die umliegenden Häuser wurden alle zerstört.
Schlimmer als der Eindruck der brennenden Häuser war es für mich, wenn der gleichaltrige Dieter, der im selben Haus wohnte, mich mit einer Gasmaske vor dem Gesicht erschreckte, ja quälte. Nach dem Fliegerangriff liefen Vater und ich auf den Speicher, löschten mit dem Sand, der bereit lag, die kleinen Feuer der Brandbomben, die doch noch durch das Dach geschlagen waren.
1944 war mein erstes Schuljahr in der Volksschule Hachenburgerstraße. Eine Erinnerung an einen Tag dieses Schuljahrs: Wer seine Tafel mit dem Buchstaben B vollgeschrieben hatte, durfte nach Hause. Ich war als erster fertig. Aber unterwegs gab es Fliegeralarm. Ich klingelte an einem Haus, wurde reingelassen, dann ging es in den Luftschutzkeller, und wieder machten mir nicht die Bomben Angst, sondern dieses Mal ein kläffender Dackel.
Risiko
Seltsam ist mir die Erinnerung, dass ich mit Dieter vor dem Parteihaus ein Spottlied gesungen habe: Heidewitzka, die Enn-Ess-Vau, die sammelt Äpelschaale für die decke Sau. (Heidewitzka, die NSV, die sammelt Kartoffelschalen für die dicke Sau. NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, die Kartoffelschalen waren für die Schweine gedacht, mit ‚dicke Sau‘ war wahrscheinlich Göring gemeint, was mir erst Jahrzehnte später deutlich wurde: Erich Hilgenfeldt, seit 1933 Leiter der NSV, war 1937 von Hermann Göring zum „Reichsbeauftragten für die Erfassung der Küchen- und Nahrungsmittelabfälle“ ernannt worden. Das Entsetzen meiner Eltern war groß, als sie von unserer Aktion erfuhren. Aber die Angst vor den Schergen des Regimes war offenbar nicht so groß, als dass meine Mutter nicht mich regelmäßig mit Butterbroten aus dem Haus schickte, die ich heimlich an einem vorgesehenen Ort für die Kriegsgefangenen ablegte, heimlich – an offenen Widerstand war nicht zu denken. In meinem katholischen Umfeld gab es eine starke Aversion gegen die Nazis; die aber wurde geheim gehalten. Man wollte nicht sein Leben riskieren. Diese Barmherzigkeit gegenüber den Kriegsgefangenen ist ein Zeugnis dafür, dass Mutters Beteuerungen wahrhaftig sind, als es darum ging, ihrem Mann aus der jugoslawischen Gefangenschaft zu helfen. So schrieb sie:
17. Juni 1947
An die Lagerleitung
des Lagers 601 Jugoslawija!
Beiliegendes Schreiben (vielleicht bezieht sich dieser Hinweis auf das Schreiben von Herrn Kurz; s. u.) besagt Ihnen, das mein Mann stehts ein großer Antifaschist war. Ich bitte herzlich die Lagerleitung zu befürworten, das mein Mann möglichst bald entlassen wird. Dasselbe Gesuch schickte ich auch an die Jugoslawische Dienststelle in Baden-Baden. Wir beide, mein Mann und auch ich, litten wirklich viel unter dem Naziregie, weil wir uns in keiner Weise in dessen Organisationen beteiligen wollten. Um so härter trifft uns jetzt das Los solange getrennt zu sein. Wir haben zwei Kinder und muß ich mich recht sauer in dieser schweren Zeit durchschlagen. Mein Mann ist nun 45 Jahre alt und oft krank. Ich bitte herzlich, helft das mein Mann doch recht bald entlassen wird.
In diesem Sinne grüßt
mit Hochachtung
Frau Maria Wieners
Köln-Kalk
Rolshoverstr. 166a
Ich vermute, dass die Formulierung ‚Antifaschist‘ ihr empfohlen wurde (siehe unten), immerhin war Jugoslawien ein sozialistischer Staat; Genaueres siehe weiter unten.
Höchst gefährlich war es vermutlich auch, mich 1942 in eine Wehrmachtsjacke zu stecken und zu fotografieren. Das hätte als Wehrkraftzersetzung interpretiert werden können.
|
|
Als Beleg, dass ich auch freundlicher aussehen kann, ein Foto aus demselben Jahr (mit Schwester):
|
|
Fliegeralarm III
Der Bunker war fertig, die Bomberangriffe häuften sich. Der Luftschutzkeller war nicht sicher genug. Unsere Wohnung war fünf Minuten vom Bunker entfernt. Das dauerte zu lang. Wir zogen in die Pfarrei direkt neben dem Bunker.
Panik: Eine große Traube von Menschen zwängt sich in den Bunker. Etwa 200 Meter entfernt fallen Bomben: Zwei oder drei Bombenabwürfe von den 1,5 Millionen über Köln in 262 Luftangriffen, wie ich aus dem Internet weiß. Ich war in dieser Traube eingekeilt, wurde von der Panik angesteckt.
Evakuierung
Köln wurde evakuiert – so hieß das damals. Vor allem Kinder wurden in Gegenden verschickt – oft weit in den Osten -, wo es keine Bombenangriffe gab. Ich hatte Glück: Meine Mutter kam von einem kleinen Bauernhof in Rott bei Hennef an der Sieg. Wir konnten dort unterkommen und ich setzte mein erstes Schuljahr in Rott fort. Wenn auch anfangs Spott und Häme der Dorfkinder störten, wurde Rott zu einem Refugium, im Laufe der Jahre zu einer Art Paradies. Bis zu meinem 15./16. Lebensjahr war ich immer dort, wenn ich nicht in Köln zur Schule musste. Sofort nach Schulschluss des letzten Schultags war ich mit dem Fahrrad unterwegs nach Rott. Von den beiden Tanten auf dem Hof, Tante Fina und Tante Anna, Schwestern meiner Mutter, die eine unverheiratet, die andere Kriegerwitwe, war ich gern gesehen, auch weil ich immer fleißig auf dem Hof mitarbeitete. Später habe ich in den großen Ferien statt auf dem Hof in Rott in der Humboldtkolonie als Punktschweißer gearbeitet, dann in einer Gärtnerei, beim Gerlingkonzern und bei der Kölner Messe – da war ich schon Student.
Der ‚Deserteur‘ - Kriegsende
Die außerordentlichen Qualitäten meiner Tante Fina (Frl. Pickenhan) sind mir erst viel später bewusst geworden, in Erinnerung an einen Vorfall gegen Kriegsende: Im Saal über dem Kuhstall - die Tanten hatten neben dem Bauernhof auch ein Lebensmittelgeschäft und eine Gastwirtschaft - hatte sich ein Standgericht etabliert. Es war der 18. März 1945. Ich saß in der Küche und hörte im Flur, der zum Saal führte, Gepolter und Geschrei: Das Gepolter kam von Soldaten, die einen Deserteur zur Verurteilung in den Saal führten, das Geschrei von meiner Tante, die außer sich die Verantwortlichen anfuhr: Es sei Wahnsinn, einen Deserteur hinzurichten, der Krieg sei sowieso bald zuende. Sie hatte keinen Erfolg, der Deserteur wurde verurteilt. Um 13 Uhr sollte er auf dem Friedhof erschossen werden. Eine Kollegin des Maximilian Kolbe-Gymnasiums in Porz-Wahn hat später in ihrem Leistungskurs ‚Geschichte‘ diesen Vorfall dokumentiert. In dieser Dokumentation findet sich ein späterer Bericht des Deserteurs. Dort ist zu lesen, dass die deutschen Soldaten aus Rott flohen, dass sie den Verurteilten statt zum Friedhof nach Stein bei Blankenberg (etwas 8 km östlich von Rott) brachten, wo das Urteil einen Tag später von einem anderen Standgericht revidiert wurde. Grund der Flucht: Die Amerikaner rückten zwei Tage später in Rott ein. Meine Erinnerung an diesen Tag der Befreiung: Ich lag in der zum Luftschutzkeller umfunktionierten Milchküche auf einer Matratze neben einem älteren Mann, der die Schwindsucht hatte und mich auch angesteckt hatte. Und ich sah zum ersten Mal einen Amerikaner: er kam die Treppe herunter, schwarz und mit einer Tafel Schokolade in der Hand – ein Klischeebild der Befreiung, aber es ist auch meine Erinnerung.
In jenem Bericht des Deserteurs ist auch zu lesen: „Frl. Pickenhan und Oberleutnant Patschewsky … haben sich ganz groß für mich eingesetzt.“ Tante Fina hatte von dem Verurteilten einen kurzen Abschiedsbrief an dessen Eltern bekommen; als sie ihn ablieferte, war der ‚Deserteur‘ schon in Kriegsgefangenschaft. Jener Oberleutnant hat sich das Leben genommen.
Überlebt
Zu den Arbeiten, die ein 6/7-jähriger Junge leisten konnte, gehörte es zum Beispiel, in der Wirtschaft als ‚Minikellner‘ das Bier rundtragen oder Zeitungspapier für die Plumpsklos neben dem Haus zurechtzuschneiden, es gehörte auch dazu, den Hof kehren - mir sehr verhasst. Ich kehrte bei dem Ereignis, über das ich berichten will, nicht allein, sondern zusammen mit einem älteren Mann. Da holte mich meine Mutter ins Haus. Ich solle mit auf den Speicher kommen. Von dort konnte man weit sehen, und das Besondere an diesem Tag: Man konnte das brennende Siegburg sehen. Es war möglicherweise der Luftangriff vom 28. Dezember 1944, bei dem 1500 Bomben (Phosphorbomben und Stabbrandbomben) über Siegburg abgeworfen wurden, oder der vom 3. März 1945; dieses Mal fielen 3000 Bomben auf Siegburg (aus dem Internet). Und während ich mir das brennende Siegburg anschaute, schlug an der Stelle, wo ich gekehrt hatte, eine Granate ein und tötete den Mann, dem ich geholfen hatte. Ohne den Brand Siegburgs wäre mein Leben also schon sehr früh beendet gewesen. Von solchen, wenn auch nicht so existentiellen Glücksfällen in meinem Leben könnte ich viele erzählen.
|
|
Das Foto zeigt den Hof: links Pferdestall und Scheune, hinten rechts ein Geräteschuppen, unter den Bäumen vorn rechts ein sehr schöner Biergarten; im Fachwerkhaus in der Mitte waren links die Küche, der Laden und die Treppe zur Milchküche, rechts die Gastwirtschaft, im ersten Stock die Schlafräume. Hinter dem Wohnhaus lag ein Saal und darunter der Kuhstall und andere Räume, z. B. ein kleiner Schweinestall, den auszumisten immer harte Arbeit war. Im Vordergrund, wo ich das Kreuz eingezeichnet habe, war die Einschlagstelle.
Sonst aber war meine Kindheit in Rott eine glückliche Zeit. Darum die ausführliche Schilderung des Hofes. Die Wege, auf denen ich an herrlichen Sommermorgen die Kühe zur Weide trieb und die Pferde holte, erscheinen mir immer noch golden beglänzt, asphaltiert wie heute waren sie nicht. Alles war wunderbar: zum Beispiel das Aufstellen der Garben - das Getreide wurde kurz nach dem Krieg von Hand geschnitten und gebunden; Pferde und Benzin für die Traktoren waren für den Krieg gebraucht worden und standen kurz nach dem Krieg noch nicht zur Verfügung. Als ich etwas größer war, durfte ich das Heu mit einem von einem Pferd gezogenen Rechen zusammenkratzen, ich durfte die Erntewagen beladen; bei Heu war das besonders schön, das Beladen der Getreidegarben war weniger schön, weil die Disteln in den Garben unangenehm stachen. Ein paar Mal kippte das Aufgetürmte um, weil ich es schlecht geladen hatte. Und schön war die Feldarbeit: Ich durfte eggen; sogar pflügen durfte ich alleine, etwa 2 km weg vom Dorf ein riesiges Feld bei Haus Ölgarten. Ich musste mir das Mittagessen mitnehmen, und mir wurde eingeschärft, dass die Pferde ihre Pause bekommen sollten. Mittlerweile waren Pferde aus dem Krieg zurück, und wir hatten zwei davon: Max und Fritz. Mit Fritz habe ich am Wochenende die Wälder um Rott erkundet – einen Sattel hatten wir nicht. Heute ist dieses ‚Paradies‘ aufgrund starker Veränderungen der Infrastruktur verlorengegangen.
Erste Liebe
Meine Tanten hatten, wie gesagt, außer der Landwirtschaft einen Lebensmittelladen und die Gastwirtschaft mit einem Tanzsaal; dort habe ich von der Empore, wo ich wegen Platzmangels schon mal schlafen musste, meiner 'ersten Liebe' beim Tanzen zugeguckt. Ich hatte sie morgens kennengelernt, als eine Gruppe von Mädchen für eine Tanzaufführung am Abend probte. Ich war 13 oder 14 und zu jung zum Tanzen, war aber selig, wenn 'sie' mir von unten den ganzen Abend lang zuwinkte - in meiner Erinnerung ist sie sehr schön und mag wohl so 16/17 gewesen sein. - eine erste Liebe setzt sich wohl in der Erinnerung unauslöschlich fest. Eine für mich ebenfalls schöne Erinnerung weist in die Zeit der letzten Kriegsmonate: Am Ende des Dorfs hatten Flakhelferinnen eine kleine Stellung; mich interessierten nicht die Flak und nicht die Scheinwerfer, sondern die Mädchen, die wohl auch 16/17 gewesen waren – für den Sechsjährigen waren es erwachsene Frauen in Uniform. Ich war gerne bei ihnen und war – wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht – auch gerne bei ihnen gesehen.
Kurz nach dem Krieg - Humboldtkolonie
Es wird 1947 gewesen sein. Wir hatten nichts zu essen und mussten unseren Lebensunterhalt zusammenhamstern, vielmehr meine Mutter musste es. Ich erinnere mich an folgende Szene: Meine Mutter und ich sind mit je einem Rucksack beladen. Wir kommen von Rott und wollen zum Zug in Hennef. Ich wusste nicht, was meine Mutter damals leistete. Ich ahnte nur etwas, als ich in ihr rotes, verschwitztes Gesicht sah. Als nun zum Abend „Der Engel des Herrn“ geläutet wurde, sagte Mutter: „Jetzt müssen wir Gott danken, dass er wieder für uns gesorgt hat.“ Wir setzten unsere Rucksäcke auf der Mauer eines Vorgarten ab und beteten dreimal das „Ave“. Mit neuer Kraft pilgerten wir dann weiter zum Bahnhof. Dort war immer ein beängstigendes Gedränge. Der Zug war so voll, dass manche auf den Trittbrettern stehen mussten – wir waren nicht die einzigen, die aufs Hamstern angewiesen waren. Diese Erfahrung und die vor dem Bunker haben wohl dazu geführt, dass ich mich immer unwohl fühle, wenn ich inmitten von Menschen sitze.
Riesenangst hatte ich auch bei einer Kohlenklau-Aktion: Ich muss auf einen Handwagen aufpassen. Meine Mutter klettert mit vielen anderen auf die Waggons eines stehenden Güterzugs. Plötzlich stürmen die Menschen an mir vorbei. Polizei war im Anmarsch; deutsche oder vom Militär der Besatzer? Ich stand mit meinem Karren schließlich ganz alleine da, bis meine Mutter mich fand.
Angenehmere Erinnerungen
Die Rolshoverstraße und die anliegenden Trümmer mit den teils erhaltenen Luftschutzkellern waren ein riesigen Spielgelände. Autos gab es praktisch nicht. Nur einmal brachte ein mit Holz angetriebener Kraftwagen aus Rott eine Gans vorbei, eine lebende, die mir auch sogleich davonflatterte. Schließlich wurde sie doch noch eingefangen und ich brachte sie zum Fettwerden zu einer Familie Kreuzer, von deren erwachsenen Söhnen einer ein guter Freund wurde und mich einmal vor dem Ertrinken im Baggerloch gerettet hatte. Diese Familie hatte in der Grembergerstraße einen Garten mit einem Häuschen, in dem sie, wohl ausgebombt, wohnten. Kennengelernt hatten wir sie, weil ese in ihrem Garten eine Wasserpumpe gab, von der ich täglich unser Wasser holte. Dort fütterten wir auch unsere Kaninchen groß. Was nicht an sie verfüttert wurde, brachte ich zu den Schwestern in einem kleinen Kloster in der Volpertusstraße. Sie hatten mich in ihr Herz geschlossen und ich sie.
Ich war wohl ein quicklebendiger, übermütiger, manchmal mutwilliger Junge, und ich muss wohl auch ehrgeizig gewesen sein. So war es ein Ziel, möglichst viele Treppenstufen nach unten zu überspringen (wir wohnten auf der dritten Etage), nicht ganz ungefährlich und manchmal zum Ärger der Hausbewohner. Beim Fußballspielen auf der Straße stand ich meist im Tor.
War das ich?
Mutwillig: Verbissen Krieg gespielt mit Jungen der Nachbarschaft, Karneval mit Schwert oder mit Revolver ausgestattet, riesige Freude über ein Fahrtenmesser - von dem späteren Pazifisten war nichts zu ahnen. Auch böswillig? Der Mutter 1.40 RM gestohlen, in Rott ein Hühnchen ertränkt zusammen mit einem Nachbarjungen, der keinen guten Einfluss auf mich hatte.
Vaters Kriegsgefangenschaft
Wie hätte sich mein Leben entwickelt, wenn mein Vater nicht aus Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrt wäre? Von November 1941 bis März 45 hatte er als Aushilfe bei der Feuerwehr gedient. Am 16. März war er noch eingezogen worden: Der Wahnsinn der Nazis mobilisierte die letzten Reserven. Er wurde in eine SS-Einheit gesteckt und nach Jugoslawien verfrachtet, dort geriet er dann sogleich in Gefangenschaft (15. Mai in Cilli, heute Celje)). Es begann eine Art Todesmarsch von fast 900 km nach Montenegro. Da die Deutsche Wehrmacht in Jugoslawien brutal gewütet und die SS einen besonders schlimmen Ruf hatte, stand Vaters Überleben auf der Kippe, später auch die Entlassung, so dass zur Entlastung des ‚SS-Manns‘ Schreiben nötig wurden, z. B. folgendes:
Ortausschuß-°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Köln-Humboldt, den 27.3.47
Köln=Humboldt=Gremberg
Politisches Leumundszeugnis
Betr.: Den Kriegsgefangenen Paul Wieners geb. am 30. 1.1902 in Essen.
Zwecks Vorlage bei der jusoslavischen Militär-Behörde, bescheinigen wir dem Kriegsgefangenen Paul Wieners, geboren am 30.1.1902 in Essen, wohnhaft in Köln-Humboldt, Rolshoverstr. 166a, nachfolgendes:
Er war weder Mitglied der NSDAP, noch deren Gliederungen.
Parteipolitisch im Sinne der Nazi hat er sich nicht betätigt und keinerlei Ämter bekleidet, nicht einmal in der NSV.
Etwas nachteiliges ist über ihn nicht bekannt, wir können ihm nur bescheinigen, dass er stehts ein ehrlicher und aufrichtiger Antifaschist war.
In seinem Privatberuf war er Küster und Organist an der St. Engelbertus-Kirche in Köln-Humboldt. Während des Krieges war er dienstverpflichtet bei der Kölner Feuerwehr, wo er bis Anfang März 1945 tätig war.
Beim Herannahen der Aliierten wurde er und die gesamte Feuerwehr zwangsweise der bankrotten Front einverleibt und befindet sich leider noch in Gefangenschaft. Wir bestätigen nochmals, dass er ein guter Antifaschist war, der großen persönlichen Mut bewiesen hat im Kampf gegen die Nazi. Alle gegenteiligen Behauptungen sind nur als Verleumdungen zuwerten.
I. A. Adam Kurz
Vorsteher°°°°Grembergerstr. 52"
Es wurde erzählt, dass Adam Kurz Kommunist war, und das war wohl auch so. Ein Kommunist also gab dem Katholiken ein Leumundszeugnis.
Auf meinem (Dienst)weg zur Kirche bin ich immer am Haus Grembergerstr. 52 vorbeigekommen und habe oft einen kleinen Mann an der Tür eines kleinen Hauses stehen gesehen; ich vermute, dass dies Herr Kurz war. Kontakte gab es keine. Das Haus aber steht heute noch.
Und Vater kam zurück, Anfang Dezember 1948; ich war also 10 Jahre alt und ein gutes halbes Jahr auf dem Gymnasium. Ich spielte am Nachmittag mit meinen Freunden auf der Straße, als er mit einem Holzkoffer vom Bahnhof kam. Als er mich heftig an sich drückte, war mir das sehr peinlich.
Soviel zu meiner Kindheit.
Die Jugendzeit
Sie war die Lebenszeit, an die ich mich nur ungern erinnere. Das lag u. a. an meiner Mischung von engstirniger Religiösität und aufgesetztem, wohl einem Mangel an Selbstwertgefühl geschuldeten Hochmut, an Versagensängsten, die auch noch mein Studium begleiteten, auch an meinem von der katholischen Kirche vermittelten verklemmten Verhältnis zur Sexualität und an verunglückten Beziehungen zu den Mädchen. Und mich wundert, dass ich doch respektiert wurde, von den Mitschülern (z. B. war ich in der Obersekunda Klassensprecher), und auch von den Lehrern:
|
|
Ich fand eine Reihe von Mädchennamen in meinem Tagebuch, das ich damals schrieb; von manchen der Mädchen weiß ich nichts mehr, außer dass die Beziehung zu ihnen stets überspannt war. Erst im Laufe meiner Zwanziger begann ich allmählich etwas reifer zu werden. Eine besonders feste Beziehung hatte ich zu einer Sechzehnjährigen; ich war 22/23, und sie spürte, dass sie zu jung für mich war, und wandte sich anderen zu. Noch ein wenig älter geworden, hätte ich gerne die eine oder aber die andere Kommilitonin geheiratet. Die waren zwar ungefähr in meinem Alter, aber schon verlobt, als ich sie kennenlernte. Das hat geschmerzt, aber es war gut so, denn die, mit der ich dann wirklich verheiratet bin, war und ist der Glücksfall in meinem Leben.
Glücksfall Marlene
hübsch und intelligent, fleißig; und mutig, wenn auch nicht unbedingt beim Reiten, aber unbedingt, wenn sie Unrecht verhindern will. Achtsam und fürsorglich. Eloquent, vor allem aus dem Bauch heraus, da trifft sie mit großer Sicherheit das Richtige. Impulsiv, kann sich aber auch zurücknehmen. Große Bereitschaft, anderen zu helfen. An vielem interessiert und angenehm großzügig (ließ mir Raum für meine Neigung zum Weiblichen, in einem bestimmten Rahmen natürlich). Eine hervorragende Köchin, die nach den Konzerten in Haus Eulenbroich (s. u.) oft an die 14 Musiker mit mehreren Gängen bedachte, und eine gute Haushälterin - schließlich war sie Buchhalterin von Beruf -, tüchtig in jeder Hinsicht; und so wundert es nicht, dass man in der Zeitung lesen konnte: Marlene Wieners als erste Frau an der Spitze der SPD gewählt - natürlich die von Rösrath (dorthin waren wir mittlerweile gezogen); aber es war eine kleine Revolution.
|
|
|
Nun ist sie die große Freude meines Alters und war mir Zeit unseres Zusammenlebens immer eine große Hilfe, auch weil ich viele Jahre meines Lebens ständig Widerstand leisten musste gegen eine unangenehme, wahrscheinlich vom Vater ererbte Krankheit: Die Ärzte sprachen von Schäden des vegetativen Nervensystems. Das Krankheitsbild war eine tiefe Erschöpfung, die mein Leben seit dem mit ‚sehr gut‘ abgeschlossen ‚Philosophikum‘, für das ich vielleicht zu viel gearbeitet hatte, sehr beeinflusst hat. Ich half mir mit Schwimmen und Jogging. Es gab auch eine längere Pause im Krankheitsverlauf: nach dem Staatsexamen bis Mitte der 80iger Jahre. Endgültige Hilfe verschaffte der Nervenarzt Dr. Hasse, der mit seinem Wissen und Engagement meinem Leben eine neue Qualität gegeben hat. Im Rückblick kommt mir diese Krankheit gar nicht mehr so belastend vor, da habe ich wohl erfolgreich verdrängt, wie so manch anderes auch; und werde mir auch keine Mühe machen, das Verdrängte wieder ans Tageslicht zu holen. Wozu auch; denn dann müsste ich es ja erneut verdrängen.
Eine große Hilfe war Marlene unter anderem auch, indem sie nicht nur auf der Schreibmaschine alles tippte, was ich schrieb, sondern es auch verbesserte. Wenn sie ihr Ok gegeben hatte, dann war es ok.
Der Organist
Hinter dem oben gezeigten Bunker ragt ein Kirchtum hervor; er gehört zur Kirche St. Engelbert; dort war mein Vater seit 1933 zuerst Küster, dann auch Organist. Vorher hatte er seine erste Stelle als Organist in Rott (1.9.29 - 31.7.32), wo er seine Frau kennenlernte. Mit 12 Jahren habe ich auf der vom Krieg arg mitgenommenen Orgel angefangen zu spielen. Mit sechzehn konnte ich schwierigere Werke spielen, z. B. Liszts B-A-C-H, das ich gut drei Jahrzehnte später (1988) auch auf der damals größten Kirchenorgel der Welt in Passau vorgetragen habe.
|
|
|
Der Orgeldienst, die Begleitung von Vaters Chor, in dem ich Marlene fand, war wichtig für mich, und die Orgel ist bis heute ein guter Ausgleich geblieben. Vom 16. bis zum 22. Lebensjahr habe ich auch Tanzmusik (zum Geldverdienen) und Jazz (zum Vergnügen, aber nicht besonders talentiert) gespielt.
Freizeitgestaltung
Nachdem das Ehepaar Wieners etabliert war, die Stadt verlassen und ein Häuschen im Grünen gebaut hatte, wurden weitere Freizeitgestaltungen ausprobiert: Viele Reisen, vor allem mit dem Wohnwagen, Segeln auf dem Bodensee, Tennis, Schlittschuh- und Schilaufen. Abfahrtski habe ich mit Begeisterung noch recht lange gemacht; vor allem aber das Reiten: Die Erinnerungen an meine Kindheit ließen mich da offenbar nicht los. Mit 50 begann ich mit Reitunterricht und einem eigenen Pferd, und noch heute ist Reiten und alles, was dazugehört, meine liebste Beschäftigung. 21 Jahre lang war ich dann im Reitstall Zinzius Vorsitzender des Reitvereins. Wichtig ist mir der Umgang mit den Pferden, aber auch der mit den Mitstreiterinnen.
Politik
Die Politik war mehr als eine Freizeitgestaltung. Willy Brandts Ostpolitik zog Marlene und mich in die SPD. Bald hatte ich auch ein Ratsmandat (1975 bis 1999). Ich wollte mich mit den Alltagsdingen auseinandersetzen, mit Straßenlaternen statt mit Hölderlin, suchte mir von der Ratsarbeit die aus, die mir neu war und für Bodenhaftung sorgte, so den Planungsausschuss und den Haupt- und Finanzausschuss. Für Bodenhaftung sorgten zudem auch acht Jahre Schöffendienst.
Ein Beispiel für viele politische Aktivitäten, wenn auch ein extremes: Ich war verantwortlich für die Arbeit der Jungsozialisten und verbreitete in dieser Funktion ein Flugblatt gegen Umweltverschmutzung. Hartnäckig Widerstand zu leisten liegt offenbar in meinen Genen, was ich ja offenbar schon in frühester Kindheit dokumentiert hatte. Ein Unternehmen in Hoffnungsthal hatte giftigen Schlamm und Chemikalien in die Sülz abgelassen, Fischsterben war die Folge. Der Unternehmer stand in meinen Augen für das System und ich bezeichnete ihn in dem im antikapitalistischen Ton gehaltenen Flugblatt als Umweltgangster. Es folgte eine Zivilklage des Unternehmens wegen übler Nachrede und es gab viel Aufregung. Der Anglerverein Hoffnungsthals hatte inzwischen wegen des Fischsterbens seinerseits das Unternehmen angezeigt, und ein kluger Richter stellte das Verfahren ein.
Kultur
Der Job als Kommunalpolitiker war nervenaufreibend und zeitaufwendig. Aber er hatte auch seine schönen Seiten. Ich wurde Vorsitzender des Kulturausschusses, ich wollte, dass die SPD ein wenig das Image verlor, sie habe zur Kultur wenig Beziehung. Ein Zentrum meiner Aktivitäten waren 250 Konzerte klassischer Musik. Mit Unterstützung meines Freunds Rainer Moog kamen Musiker aus der ganzen Welt nach Rösrath zu den Schlosskonzerten in Haus Eulenbroich, das die Presse als ‚Mekka der Kammermusik‘ bezeichnete. Nach dem Konzert saß man dann entspannt bei Wieners bei leckerem Essen zusammen. Später habe ich diese Tätigkeit in der ServiceResidenz Schloss Bensberg fortgesetzt, bis Corona dem ein Ende setzte. Ein bleibendes Dokument sind die Programmhefte, in denen ich die aufgeführten Werke genau beschrieben hatte und später auf meiner Webseite veröffentlicht habe.
Die Dissertation
Es wundert mich, dass mir wenig zu meinem Studium einfällt. Wenn ich Angaben dazu machen musste, habe ich aufaddiert: Germanistik (im Zentrum die Beschäftigung mit Hölderlin), Altertumskunde (Latein), Pädagogik, Philosophie, Geschichte, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Theologie. Klingt ein wenig großsprecherisch; das Studium hat ja auch recht lange gedauert, und ich habe auch nur in den ersten vier Fächern Abschlüsse gemacht. Wichtig ist mir bis heute meine Dissertation. Als Ganzes und als vortragsmäßige Zusammenfassung ist sie auf meiner Webseite zu lesen unter ‚Wolfram von Eschenbach‘. In Kürzestform charakterisiert: Es geht um die Frage nach der Schuld des Menschen, die ich als ‚unschuldige Schuld‘ interpretiert habe – höchst ungewöhnlich für einen mittelalterlichen Text und entsprechend ungewöhnlich innerhalb der Forschung über Wolframs ‚Parzival‘. Ich finde es immer noch bewundernswert, dass mein Doktorvater Prof. F. Tschirch diese Arbeit angenommen hat. Zum großen Teil wurde sie auf einem Bauernhof in Scheid bei Much geschrieben, auf den ich mich geflüchtet hatte, weil es in Köln zu viel Ablenkung gab. Die besten Ideen kamen mir dort, wenn ich die Kühe von der Weide holte und hinter ihnen her zum Stall trottete. Mein Vater war stolzer auf den Doktortitel als ich – mit Recht, denn die Begeisterung für Literatur war sein Erbe. Aus meiner Sicht war die Widmung ‚Meinen Eltern‘, die ich der Arbeit vorangesetzt hatte, Dank und auch eine kleine Entschädigung dafür, dass ich an Vaters Tätigkeit als Chorleiter oft etwas auszusetzen hatte.
Bürgernähe - Schwimmbad
Irgendwann stand ich an der Spitze der Vereine Hoffungsthals. Es begann damit, dass die gegnerische Ratsfraktion das Hoffnungsthaler Schwimmbad zugunsten eines Kombibads im Ortsteil Rösrath schließen wollte. Ich war sehr darauf bedacht, dass meine Partei im Ort angesehen war als die, die mit Elan alles besser machte. Und so gründete ich mit Freunden 1976 einen Verein als Widerstand gegen die Schließung des Bads, als Plattform, von der aus man Einfluss nehmen konnte. Aufgabe des Vereins, dessen Vorsitzender ich dann 25 Jahre lang war: „Das Schwimmbad in Hoffnungsthal zu erhalten und zu fördern" (so der Satzungstext). Und als dessen Erhalt gesichert war, wurde die Förderung des Schwimmbads Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Und kein Politiker traute sich mehr an das Freibad heran. So kann sich Hoffnungsthal heute mit dem „schönsten Freibad in NRW“ schmücken.
Bürgernähe - Ortsring
Nach Meinung von Erwin Schiffbauer, dem politischen Schwergewicht unserer Partei in Rösrath, war es dringend geboten, sich um die Vereine zu kümmern. Also ging ich Oktober 1978 zu der Versammlung, auf der sich alle Vereine Hoffnungsthal zu mehr Zusammenarbeit zusammenschließen wollten. Sie versprachen sich von diesem Zusammenschluss eine Belebung der Geselligkeit in Hoffnungsthal. In diesem Kreis fühlte ich mich zunächst gar nicht wohl. Immerhin war ich ein Zugereister und kannte mich im Hoffnungsthaler Vereinswesen überhaupt nicht aus. Ich musste mir eine bislang fremde Welt erobern. Also habe ich mich dann wohl doch zu Wort gemeldet; denn als es um die Wahl eines Vorstands ging, guckte man mich zum Schriftführer aus, das blieb ich, bis ich für die Jahre 1985 bis 1997 immer wieder zum Vorsitzenden gewählt wurde. Der scheinbare Nutzen für meine Partei war im Laufe der Jahre in den Hintergrund geraten und die Freude an der Arbeit des Ortsrings (so nannten wir den ‚Dachverband‘), vor allem auch an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, wurde die entscheidende Motivation. Zu organisieren war die Maikirmes mit Fahrgeschäften, mit Tanz im Zelt und mit dem bis nach Köln bekannten Badewannenrennen.
|
|
Da standen jedes Jahr rund 1000 Menschen an den Sülzufern.
Zu organisieren war der Weihnachtsmarkt und das Schmücken des Weihnachtsbaums. Viele Jahrgänge von Kindern aus den Kindergärten haben dieses Schmücken mit Nikolaus, kleinen Leckereien und Glühwein für die Erwachsenen miterlebt. Es gab den Karnevalszug, den ich stolz mit einem geschmückten Traktor anführte.
|
|
Alle drei Jahre war für die gesamte Gemeinde der Volkstrauertag zu gestalten, der meine Handschrift in besonderer Weise trug. Das Wichtigste waren für mich die Feiern bei den Goldhochzeiten, von der Feuerwehr, von der Singgemeinschaft, die ich manchmal auch dirigierte, und von Verwandten und den Nachbarn gestaltet. Ich gab in einer Ansprache einen Überblick über 50 Jahre Ehe; ich hatte mich vorher mit den Goldhochzeitern zusammengesetzt, denen auch schon mal die Tränen kamen, wenn auf einem solchen Fest ihr Leben vorgeführt wurde.
Mein Vorgänger im Vorsitz hat mir mit seinen Worten bei meinem Ausscheiden aus dem Ortsring den Abschied versüßt: Im Protokoll ist seine Laudatio zu lesen: Peter Wieners, der insgesamt 19 Jahre im Vorstand mitgearbeitet und sogar 12 Jahre die Geschicke des Ortsringes als Vorsitzender geleitet habe, sei sehr um Zusammenhalt der angeschlossenen 10 - 12 Vereine bemüht gewesen. Viele Stunden seines Lebens und auch die dazugehörige Kraft habe er umsichtig und stets erfolgreich eingesetzt. Obwohl jeder Verein mit seinen eigenen Interessen ausgelastet schien, sei es ihm immer noch gelungen, tatkräftige Helfer in den Vorstand des Ortsringes zu aktivieren.... Er habe sich nie gescheut, den Hauptanteil der Arbeiten zu übernehmen.“ 19 Jahre Ortsring waren ein bewegtes Leben, es gab manchen Ärger, eine Menge Arbeit, aber auch Anerkennung und Spaß.
Der Beruf
All das war sehr zeitaufwendig, und ich kann heute schwer nachvollziehen, wie ich das alles geschafft habe, denn meine Haupttätigkeit war ja die als Lehrer, und meine Schüler/innen wollte ich nicht vernachlässigen. Im Gegenteil: ich wollte mich für sie in besonderer Weise engagieren. So wurde ich für die Schüler jemand, bei dem sie in der Schule frei durchatmen konnten.
|
|
1968 Gymnasium in Remscheidt-Lennep
1. Referendarjahr, aber schon Klassenlehrer
Mehr als viele andere Kollegen habe ich mich um sie gekümmert. Die meisten Schüler waren dankbar und anhänglich. Da Selbstlob schwierig zu formulieren ist, möchte ich zwei Beurteilungen zitieren. Eine aus einem Album, das mir Schüler/innen zur Pensionierung schenkten, und eine von der Behörde, als es um eine Beförderung zum Studiendirektor ging.
Zunächst also die Äußerungen der Schüler/innen aus diesem Album: „ ... als erstes wollte ich Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis danken, welche Sie in den vergangenen drei Jahren aufgebracht haben. Sie waren für mich nicht nur ein Lehrer, sondern im Gegensatz zu den meisten anderen Lehrern ein Vorbild. Sie haben sich für Ihre Schüler eingesetzt und immer versucht, das Beste aus ihnen herauszuholen, auch wenn es manchmal sehr mühsam war. Dank Ihnen hat sich mein Interesse für die Literatur gesteigert … Und einige andere Äußerungen: „Sehr geehrter, lieber Herr Wieners, ich hatte Sie zwar nie im Unterricht, aber immer, wenn ich Sie gesehen hab, hatten Sie ein fröhliches Lächeln auf den Lippen, und damit waren Sie einer der wenigen Lehrer, der diese liebenswürdige Ausstrahlung hatte, und es ist schade, dass wir dieses nun bald missen werden.“ „ … Sie waren einer der Menschen, die meine Art, Dinge zu betrachten und sie zu beurteilen, geprägt und mir neue Horizonte eröffnet haben … „Außerdem danke ich Ihnen für Ihre Menschlichkeit und für Ihre Bereitschaft, sich auf die Schüler einzulassen.“ „ … ich möchte Ihnen für die drei tollen Jahre danken, in denen Sie unser Klassenlehrer waren. Sie waren immer hilfsbereit und freundlich – einfach für ihre Schüler da …“ „… unter Ihrer Aufsicht habe ich drei schöne Jahre an der KTS verlebt. Sie haben mich und die ganze restliche Klasse durch gute und schlechte Zeiten begleitet und Sie haben nie aufgehört, das Gute in einem zu suchen. Sie haben immer oder besser fast immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, auch wenn es mal nicht so lief, wie es laufen sollte …“ „Lieber Herr Wieners, ich wollte mich dafür bedanken, dass ich an Ihrem Unterricht teilnehmen durfte und somit so viel lernen konnte. Ich habe mich aber nicht nur an Ihrem Unterricht bereichert, Ihre ganze Weltanschauung hat mich auch sehr viel weitergebracht. Sie sagten einmal, Sie hätten die Hoffnung aufgegeben etwas zu verändern oder zu bewegen. Doch ich kann Ihnen versichern, Sie haben was bewegt!! Sie haben in meinem Leben was bewegt. Es ist schade, dass wir nun auf Sie als Lehrer, der für seine Schüler immer da war, und als Mensch, der unter vielen durch seine Menschlichkeit auffiel, verzichten müssen …“ Und ein letzter Beitrag: „ …jeder von uns wird versuchen, Ihr Wissen und Ihre Ratschläge weiterzugeben…“
Andere Eintragungen in diesem Album klingen nicht ganz so euphorisch, aber ähnlich; wer mit mir nicht einverstanden war – und auch solche gab es -, hat sich nicht im Album eingetragen. Es tut gut, diese Äußerungen der Schüler/innen hier niederzuschreiben. Ich gewinne so den Eindruck, dass ich nicht umsonst Lehrer gewesen bin.
Ein kleiner Nachtrag: Eine Referendarin, die ich nur vom Lehrerzimmer her kannte, bedauerte meinen Weggang: Nun gebe es niemanden mehr, der so hübsche Komplimente machte – da dachte man noch nicht an ‚Me too‘, da war ein Kompliment noch etwas Schönes und wurde nicht als Anbahnung einer Vergewaltigung verstanden.
Und hier in Auszügen die Beurteilung der Schulaufsicht (September 1989):
Erwähnt werden dort zunächst die Sonderaufgaben: u. a. Aufbau und Betreung der Lehrerbibliothek, Organisation der differenzierten Mittelstufe.
Von den folgenden Zitaten der eigentlichen Beurteilung meine ich, dass sie zutreffen, zumindest meine Absichten treffen. Und so ist zu lesen: „Den Schülern begegnet er mit einer aufgeschlossenen und freundlich zugewendeten Einstellung. In einer spannungsfreien Unterrichtsatmosphäre arbeiten die Schüler gern und erfolgreich mit….Sie schätzen neben seinem fachlichen Können seine sensible Art. Er ist für sie in vielen Fällen ein geschätzter Gesprächspartner und Ratgeber. Dies wird auch deutlich in der Tatsache, dass Herr Dr. Wieners seit acht Jahren Verbindungslehrer ist.
Die Wertschätzung seiner Fachkollegen wird sichtbar in der kontinuierlichen Wiederwahl zum Fachvorsitzenden in Deutsch. Doch auch im Fach Latein leistet Herr Wieners Hervorragendes. Das von ihm erreichte Leistungsniveau wurde mehrfach von der Schulaufsicht anerkannt. Seine musische Begabung – er spielt Orgel und Klavier – ermöglicht seinen Einsatz seinen Einsatz im Fach Musik.
... Auf Schulfesten und kleineren Schulveranstaltungen ist seine Mitarbeit stets erwünscht und fast schon eine Garantie für ein sicheres Gelingen.
Sein dialogischer Stil und seine ausgeprägte demokratische Haltung machen ihn zu einem immer ansprechbaren und hilfsbereiten Lehrer und Kollegen.
Die Schulrätin, die die 2. Philologische Staatsprüfung geleitet hatte, fand, dass ich als Lehrer nicht geeignet sei. Ich war ihr zu links und zu radikal. Sie sorgte für schlechte Prüfungsnoten, und wenn ich nicht schon bessere Vornoten gehabt hätte, hätte ich nicht Lehrer werden können und mein Leben wäre anders verlaufen.
Nachwort
Wenn ich mich im Nachhinein frage, warum ich diese Erinnerungen geschrieben und vor allem warum ich sie veröffentlicht habe, muss ich antworten: Ich wollte mich selber einer glücklichen Kindheit und eines anerkannten Lebens vergewissern. Eine weitere Motivation hat etwas mit meinem Alter zu tun – mittlerweile 85. Das Alter führt dazu, dass ich nichts mehr Besonderes leisten kann, dass ich mir deshalb oft vorkomme, wie an den Rand gestellt. Und so wollte ich wohl mit meinen Lebenserinnerungen zeigen, dass ich wer war, dass ich mal wichtig und anerkannt war. Das hat dann sicherlich die Auswahl bei meinen Erinnerungen bestimmt.
|
 Autobiographisches Autobiographisches
|
 |
 |
 |
|