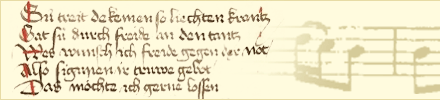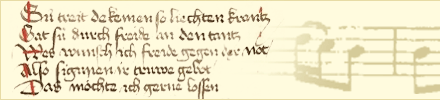81 Ebda. S. 53
82 vgl. 102,26-103,5; 113,16 ff.; 146,6
83 J. Schwietering ,Natur und art‘; in: ZfdA 91 (1961/62) S. 108-137; S. 114 f.; jetzt in: J. Schwietering ‚Philologische Schriften‘ hrsg. von F. Ohly und M. Wehrli, München 1969
84 vgl. J. Schwietering, ebda. S. 120
84a slich: leise gleitender Gang, , Schleichweg
84b ‚Die Rache an meinem Vater ist von meiner Seite aus nicht vergessen. Seine Gemahlin, die mich geboren hat, wählte den Tod aus Liebe zu ihm, da sie mit ihm ihre Liebe verlor.‘ gerich stm. die rache, die strafe; unverkorn partic. adj.: nicht unbeachtet, nicht vergessen; kiusen: wählen, erwählen, verliesen: verlieren
85 Ironisch hebt Wolfram die Berechtigung zu dieser Anklage auf, indem er Feirefiz die Frauen ebenso behandeln läßt wie sein Vater (771,15-19; 811,4-16). Daß ein solches Verhalten nicht unproblematisch ist, erweist Repanses Freude über den Tod der Königin Sekundille (822,15—22).
86 Herzeloyde weist darauf hin, indem sie verlangt:
nu ânet iuch der heidenschaft,
und minnet mich nâch unser ê (94,14/15; ânen mit Gen.: u. a. verzichten; ê, êwe: endlos lange Zeit, altherkömmliches Recht, Gesetz, Norm des Glaubens, Ehe).
86a Das Böse in ihm war eingesunken; sîhte adj. seicht, nicht tief, eingesunken
86b Jeder Makel floh ihn; missewend: unrechte wendung, das abweichen vom bessern zum schlechtern, allgem. u. zwar: tadel, makel, schande
86c Wodurch die Taufe sich auszeichnet, das pflegte er: unwandelbare Treue; jede unrechte Tat wusste er zu vernichten; die Beständigkeit seines Herzens lehrte ihn das; êren: ehren, preisen, auszeichnen, zur ehre gereichen; phlegen: wofür sorgen, sich mit freundlicher sorge annehmen, pflegen mit gen.; ver-krenken swv. ganz kranc machen: schwächen, herabsetzen, beschimpfen, vernichten
87 Gemeint ist die feie Terdelaschoye von Feimurgan, die Begründerin des Geschlechts der Anschouwe (56,17-19). Martin weist (zu 56,18) darauf hin, daß dem feie „lat. Fata, die personifizierte Schicksalsgöttin“, zugrunde liegt.
87a Seine Abstammung von der Fee nötigte ihn zu lieben oder Liebe zu suchen: gern, geren: begehren, verlangen,; müeʒen swv. tr.:nötigen, zwingen
87b Ich ziehe wegen meiner Ehre zu Ritterkämpfen in fremde Lande. Herrin, es ist mir so zuteil geworden; durch: u. a. wegen; wirdecheit: was wert u. würdig ist, würdigkeit, hohes ansehen, herrlichkeit, amt, u. würde, ehre, auszeichnung; wenden, gewant: zu teil geworden
88 Eine weitere Rechtfertigung Gahmurets wäre möglich, wenn man seine sene nach rîterschaft als Allegorie für den Weg des Menschen zu Gott verstünde, für den Weg, über dem das Augustinische inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (conf. I, 1,1) stehen könnte. Die Absicht Gahmurets, niemandem zu dienen wan eines der die hoehsten hant/trüege ûf erde übr elliu lant (13,13/14), macht eine solche Interpretation wahrscheinlich, zumal Wolfram mit dieser Umschreibung sonst Gott bezeichnet (vgl. Martin zur Stelle). Doch gibt es keinen sicheren Hinweis dafür, daß Gahmurets Lebensweg in dieser Weise ,mystice' gedeutet werden könnte. Vgl. dazu Th. Mann ‚Joseph und seine Brüder‘ Fischer S. 316f.
88a Seit er von der Einfalt befreit war, da wollte die von Gahmuret ererbte Veranlagung ihn nicht davon freilassen, der schönen Liaze zu gedenken. erlâzen: mit acc. u. gen. (od. untergeord. satze) jemanden wovon frei lassen, ihm es erlassen; denken: denken, gedenken (mit refl. dat., mit gen. der sache oder an, gegen, nâch
88b Ungezählte Verwandtschaft und eine aus des Vaters und der Mutter Natur geerbte Not trennte ihn völlig von seiner Vernunft
art: herkunft, abkunft ; angeborne eigentümlichkeit, natur; beschaffenheit; erben: swv. prät. erbete, arpte , part. geerbet, gerbet tr.von seite des erben: mit acc. d. sache durch erbschaft erhalten, ererben, erben
88c er-strecken swv. prät. erstracte, erstrahte: ausstrecken, ausdehnen
88d winster: link; war: wohin
89 „Wenn kuski allgemein das Geziemende ist, so liegt . . . von vornherein in ihm der Begriff des sich Beherrschens, des sich Zügelns, des Maß- und Zuchthaltens . . . wird zum Inbegriff der sobrietas, der höchsten Tugend.“ (Th. Frings und G. Müller ,Keusch'; in: Erbe der Vergangenheit [vgl. Anm. 67] S. 109-135; S. 125) Ehrismann sieht in kiusche eine Übertragung des lat. temperantia (,Über Wolframs Ethik' [vgl. Anm. 67] S. 440).
90 die mit kiusche lember wâren
und lewen an der vrecheit (737,20/21);
dâ diu vrävel bî der kiusche lac (734,25);
dô der kiusche vrävel man (437,12);
er was noch kiuscher denne ein wîp:
vrecheit und ellen truoc sîn lîp (26,15/16);
vrävel: Mut, Kühnheit, Unerschrockenheit, Verwegenheit; vrecheit: Kühnheit, Keckheit, Verwegenheit
kiusche und vrecheit bestimmen sich gegenseitig in ihrem Maß: die vrecheit bewahrt die kiusche vor bangem Zaudern, die kiusche bewahrt die vrechheit vor Tollkühnheit.
90a Sein Ruhm rückte ihn so hoch hinauf, dass keiner an dessen Endpunkt heranreichte, wo immer man noch Ritter prüfen/vergleichen will; swâ conj.: wo immer, wo
91 vgl. Boethius ,Consolatio': virilis animi robur; I, Prosa 2
91a vreise: Schrecken, Gefahr
92 vgl. Röm 8,17: Si autem filii, et heredes: heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.
92a saelde: güte, wolgeartetheit; segen, heil, glück (von gott), personif. Sælde, vrou Sælde (auch swf.), die verleiherin aller vollkommenheit, alles segens u. heiles.
92b Da trug der junge Parzval das Aussehen eines Engels ohne Flügel, so sehr auf der Erde aufgeblüht.
93 G. Keferstein ,Parzivals ethischer Weg‘ (vgl. Anm. 60) S. 33
94 Fr. Maurer ‚Parzivals Sünden‘ (vgl. Anm. 7) S. 61
94a vuore: Fahrweg, Straße: Gefolge, Lebensweise,
95 Wahrscheinlich kannte Wolfram dieses Motiv u. a. aus Chrestiens ‚Wilhelm von England‘, in dem zwei Königssöhne, von Kaufleuten erzogen, sich, ohne um ihre Herkunft zu wissen, dem handwerklichen Beruf, den sie erlernen sollen, widersetzen (vgl. J. Schwietering ,Natur und art' [vgl. Anm. 83] S. 134).
95a newëder: enwëder pron. keiner von beiden.
96 ,Die Soltane-Erzählung . . .‘ (vgl. Anm. 70) S. 15
97 Ebda. S. 53
98 Schwietering ,Natur und art‘ (vgl. Anm. 83) S. 130
99 vgl. U. Pretzel ,Das Mittelhochdeutsche Wörterbuch‘; in: Das Institut für deutsche Sprache und Literatur (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Berlin 1954; S. 105-123; S. 117
99a So belohnt jedoch die Ritterschaft: Ihr Ende ist ein Knoten von Stricken der Trauer; zagel: Schwanz, Ende; jâmerstric stm.: band der trauer; haft: Haken, Knoten
100 vgl. 314,12; vgl. Wh 280,17-20:
wan jâmr ist unser urhap, urhap:sauerteig, anfang, ursprung, ursache
mit jâmer kom wir in daz grap.
ine weiz wie jenez leben ergêt:
alsus diss lebens orden stêt.
Denn unter Tränen werden wir geboren,
mit Tränen fahren wir ins Grab.
Wie das jenseitige Leben sein wird, weiß ich nicht,
so aber ist es in diesem Leben.
Übersetzung:D. Kartschoke; urhap:sauerteig, anfang, ursprung, ursache
100a Wer die aus treuer Liebe erleidet, dessen Seele vermeidet das Höllenfeuer. Die erduldete eine Frau aus treuer Liebe; dafür wurde ihr im Himmel ein beständiges Geschenk mit unendlicher Gabe;
niuwe: u. a. sich stets erneuernd, nie veraltend, beständig
|