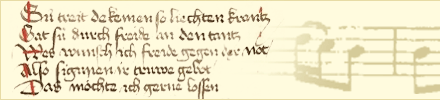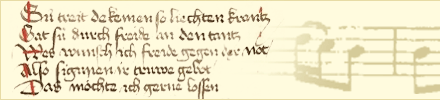3. KAPITEL
Zweifel und Glaube
Wolfram kann die Frage nach dem Sinn des Leids nur stellen, wenn zuvor dessen Herkunft deutlich geworden ist. Beim Nachdenken über die Herkunft des Leids bleibt Wolfram nicht beim Menschen stehen, durch dessen Handeln das Leid in die Welt kommt. Denn immer wieder weist er mit modern anmutender psychologischer Scharfsichtigkeit darauf hin, wie sehr das Handeln des Menschen durch seinen art und seine Unerfahrenheit bestimmt ist (vgl. o. l. Kap.). Dass der Mensch, durch art und Unerfahrenheit in die Irre geführt, sich vergeht, ist auch für Wolfram Folge einer Erbschuld; doch durch die psychologische Motivation der Irrtümer, durch deren Zurückführung auf den art und die Unerfahrenheit entschuldigt Wolfram den Einzelnen, so dass der Schuldiggewordene als unschuldiges Opfer der Erbschuld erscheint (vgl. o. S. 21 f.) und nicht als jemand, dem das Ererbte zugerechnet werden kann (vgl. o. S. 19). Immer gestaltet darum Wolfram seine Helden als reine Menschen, und oft genug spricht er es aus, dass er ihr Tun entschuldigt. Entsprechend können auch die Fälle gedeutet werden, in denen der Mensch bei objektiv gutem oder wertfreiem Verhalten dennoch sich schuldig macht (vgl. o. S. 8): auch diese Taten sind Folge einer sich aus der Erbschuld herleitenden Blindheit; und auch hier ist der Verblendete nicht strafwürdiger Sünder, dem Gott gerechterweise seinen Beistand entzieht - als Strafe für den Missbrauch von Freiheit -, sondern ein bemitleidenswerter, unschuldiger Mensch, dessen Nichtigkeit nur darum offenbar wird, der nur darum in Schuld fallt, weil Gott ihm seine Hilfe entzogen hat.
Die Frage nach der Herkunft von Schuld und Leid ist somit beantwortet (vgl. o. S. 15 f.). Aufgrund dieser Antwort wird die Frage nach dem Sinn - warum Gott jenen Opfern der Erbschuld nicht geholfen hat - um so dringlicher, da er anderen, die nicht besser sind, seinen Beistand nicht versagt (vgl. o. S. 27 f.). Vor diese Frage stellt Wolfram seinen Helden, der sich schuldig und entehrt findet und doch nicht sich die Schuld zuschreiben kann, der den Sinn solchen Leids nicht erkennen kann und sich von Gott verlassen fühlt: die Güte und Allmacht Gottes sind ihm unsichtbar geworden; Gott erscheint ihm fern und verborgen.
Parzivals Zweifel
Parzival hat erfahren, dass seinetwegen die Gralsburg unerlöst geblieben ist und er sich selbst der saelde des Grals und des Gralskönigtums beraubt hat; darüber hinaus wird er von der Gralsbotin verflucht; Cundrie ver(82)schließt ihm den Himmel und überantwortet ihn der Hölle; sie spricht ihm der werlde êre ab, die er eben erst in vollkommener Weise gewonnen hatte und deren ein Ritter, um in der Welt leben zu können, notwendig bedarf. Da aber Parzival die Ursache für sein Unglück nicht bei sich selbst suchen kann - er weiß sich unschuldig -, klagt er Gott an:
Der Wâleis sprach ,wê waz ist got?
waer der gewaldec, sölhen spot
het er uns pêden niht gegebn,
kunde got mit kreften lebn.
ich was im diens undertân,
sît ich genaden mich versan.
nu wil i'm dienst widersagn:
hât er haz, den wil ich tragn (332,1-8). (215b)
Parzival hat Gott, auf dessen genade hoffend, wie ein Lehnsmann dem Lehnsherrn in triuwe gedient. Ein getriuwer Lehnsherr aber bewährt seine triuwe durch seine Hilfe (vgl. o. S. 47). Nun ist diese Hilfe ausgeblieben, der Lehnsherr hat den Treuebund nicht gehalten, Gott muss also - so erscheint es Parzival -, wenn nicht treulos, so doch ohne gewalt und ohne kraft sein. Ein Wesensattribut Gottes also, die Allmacht, wird von Parzival in Frage gestellt. Wenn aber eine wesentliche Eigenschaft Gottes bezweifelt wird, so zerbricht das ganze Gottesbild, und konsequenterweise kann Parzival, wenn er ihm seinen dienst aufsagt, erwarten, dass Gott mit Feindseligkeit antwortet, dass Gott nicht der gütige Gott ist. Wie es komme, dass Gott ohnmächtig und wohl auch feindselig sei, wird nicht bedacht.
Als Parzival sich später, bei Kahenis, noch einmal darüber beklagt, dass Gott ihn solcher Verhöhnung ausgeliefert habe, unterdrückt er aus Rücksicht auf sein Gegenüber seine Empörung und stellt nur fest, dass Gott nicht zu seinem Bund gestanden hat:
mîn sin im nie gewancte,
von dem mir helfe was gesagt:
nu ist sîn helfe an mir verzagt (447,28-30).
Ein letztes Mal noch spricht Parzival von seinem haz (sît ich gein dem trage haz; 450,18), als er sich entschließt, nicht mit dem frommen Kahenis zu ziehen; und wieder lehnt er sich dagegen auf, dass Gott den Treuebund nicht gehalten hat:
der hât sîn helfe mir verspart
und mich von sorgen niht bewart (450,21/22).
Warum Gott nicht geholfen hat, ob er nicht konnte oder nicht wollte, wird hier nicht mehr gesagt. Auch klingen Parzivals Worte resignierter, die Kraft der Empörung erlahmt (sich huop sîns herzen riuwe - Schmerz, nicht Reue; 451,8), und er erinnert sich, dass Gott als der Schöpfer der Welt ja doch Macht haben müsse: (83)
alrêrste er dô gedâhte,
wer al die werlt volbrâhte,
an sînen schepfaere,
wie gewaltec der waere (451,9-12).
Doch der Zweifel an der Allmacht Gottes ist immer noch nicht restlos geschwunden:
er sprach ,waz ob got helfe phligt,
diu mînem trûren an gesigt? (451,13/14); (215c)ist hiut sîn helflîcher tac,
sô helfe er, ob er helfen mac’ (451,21/22).
Je sicherer aber Parzival wird, dass Gott helfen kann, desto mehr drängt sich ihm die Frage auf, ob Gott denn nicht helfen will; ist hiut sîn helflîcher tac. Dieser Gedanke entflammt seine Empörung erneut:
ouch trage ich hazzes vil gein gote (461,9);
kunde gotes kraft mit helfe sin, (215d)
waz ankers waer diu vreude mîn? (461,13/14)
Gott hat zwar Macht, aber sie bringt nicht Hilfe:
des gihe ich dem ze schanden,
der aller helfe hât gewalt,
ist sîn helfe helfe balt,
daz er mir denne hilfet niht,
sô vil man im der hilfe giht (461,22-26). (215e)
Dass Gott nicht hilft, obwohl er helfen könnte, dass Gott also nicht helfen will, dieser Gedanke muss Parzival mehr noch erschüttern als der, dass Gott keine Macht hat zu helfen: Ist Gott etwa launisch, ungerecht, treulos (valsch), böse? Wo sind, die Kriterien, die ihn vom Teufel unterscheiden, von dem es heißt: untriwe in niht verbirt (119,26)? (215f)
Persönlicher Gott und tragisches Geschick (Vergleich mit der Theodizee der griechischen Tragödie)
Wolfram ist zu fest im Mittelalter und dessen Vorstellungen verwurzelt, als dass er Parzival angesichts seiner Verlassenheit die Existenz Gottes leugnen lassen könnte. Gott bleibt in jedem Fall für Parzival Realität, die ihm nun ungeheuer geworden ist, weil ihr Wesen zerfallen zu sein scheint, weil sie undeutbar geworden ist. Nicht also, d a s s Gott ist, wird von ihm bezweifelt, sondern w a s er nach christlicher Lehre sein soll: waz ist got?. So gibt es für Parzival nur zwei Möglichkeiten, sich im Blick auf das Übel in der Welt, von dem er betroffen ist, zu verhalten: gläubige Hingabe, die an einer göttlichen Sinngebung des Leids und damit an Gottes Allmacht und Güte auch noch festhält, wenn dieser Sinn unbegreiflich bleibt, und Trotz, Auflehnung gegen Gott, der nicht helfen kann oder nicht helfen will (216).
(84) Da eine ‚geschlossene tragische Weltsicht’ (vgl. o. S. 17), wie sie etwa der Sophokleischen Tragödie zugrunde liegt, und Parzivals Auflehnung gegen Gott den gleichen Ursprung haben: die Erfahrung des Übels in der Welt, durch das der Mensch ohne sein Wollen schuldig wird, ist ein Vergleich möglich, durch den Parzivals Haltung dem Göttlichen gegenüber von den religiösen Vorstellungen einer geschlossenen tragischen Weltsicht abgegrenzt und somit weiter verdeutlicht werden kann.
Man könnte zunächst vermuten, Wolfram habe, wenn er Parzival von der Ohnmacht oder von der Feindseligkeit (haz) Gottes sprechen lässt, wie die griechischen Tragiker eine Schicksalsmacht im Sinn, die für ihn Gott sei oder die sogar über Gott stehe, mächtiger sei als er. Wolfram habe diese Macht dann, wie es im Hildebrandslied geschah (wewurt; vgl. o. S. 15), unvermittelt neben den christlich gedeuteten Gott gestellt. Für diese Vermutung sprechen einige Redewendungen, die dem griechischen δεî verwandt zu sein scheinen: Als Parzival von der minne völlig geblendet ist, heißt es: ... daz muose et alsô sîn (300,13); dass Gahmuret auf Ritterfahrt zieht, ist ihm durch seinen art bestimmt: ... ez ist mir sus gewant (11,8; vgl. o. S. 39); dass Gawan Ehre und Ruhm gewinnt, ist sein gesetze (378,27); in Gottfrieds ‚Tristan’' ist es der billich(217), der das Geschehen bestimmt; vom Schicksal Parzivals heißt es wie von dem Christi
. . . wan ez muoz sîn
daz er nu lîdet hôhen pîn,
etswenne ouch freude und êre (224,7-9; vgl; Luk 24,26);
und wieder sagt der Erzähler, als Cundrie erscheint: ... daz muose et sîn (312,17). Die Kommentare sprechen hier von der Bestimmung durch das Schicksal (Marti zu 224,7), von einer „durch das Schicksal bestimmten Notwendigkeit„ (Martin zu 224,7), so wie bei billich an eine „selbständig waltende und wirkende Macht"(218) gedacht wird. Auch U. Pretzel übersetzt das gelücke, dass Parzival und Condwiramurs wieder zusammengeführt wurden, mit „Schicksal"(219).
Der Deutung dieser Stellen aber: in Wolframs Roman sei eine unpersönliche und darum blinde Schicksalsmacht das Bestimmende, widerspricht die Überlegung, dass dort, wo man das menschliche Leben durch ein notwendiges, unveränderliches, unbeeinflussbares Schicksalsgesetz bestimmt sieht, der zwîvel keinen Ort haben kann, und ebenfalls nicht verzweifelter Trotz und verzweifelte Rebellion, wohl aber Schauder und Entsetzen in Bezug auf die Schicksalsmacht oder auch Verachtung der Götter, die, unter dem Schicksalsgesetz stehend, allzu menschlich erscheinen (Prometheus des Aischylos); oder auch Frömmigkeit, die aber von ganz anderer Art ist als die christliche.
(85) Die Frömmigkeit des Sophokles (220) ist ein Sich-Beugen unter das Gesetz, das den Sterblichen Leid (221) und den Göttern Glückseligkeit zuschickt, ein Gesetz, das er wie Heraklit (Fr. 32) auch Zeus (222) nennt. Je tiefer er das Leid erkannte, um so deutlicher wurde ihm dieses Gesetz; Auflehnung wird nicht provoziert, da dieses Gesetz nicht als ein solches angesehen wird, das nur das Gute bewirkt, sondern als solches, das beides: Heil und Unheil schickt.
Wolframs (christliche) Vorstellung von einer die Geschicke bestimmenden Macht ist grundsätzlich anders als die der Griechen(223). Der Zweifel Parzivals und Parzivals Empörung gegen Gott sind nur darum denkbar, weil Parzival in einem persönlichen Verhältnis zu einem persönlich gedachten Gott stand, so zu Gott stand wie ein Lehnsmann zu seinem Lehnsherrn, von dem aufgrund seiner triuwe immer helfe zu erwarten war und der, wie der sich empörende Parzival schließlich auch zugibt (vgl. o. S. 82 f.), auch helfen könnte, da seine Macht durch nichts eingeschränkt ist.
Von der Allmacht Gottes her aber kann auch das gesetze gedeutet werden, das in Wolframs Roman dem Menschen das Seine zuschickt und das gemeint ist, wenn Wolfram von gelücke, von gewant und von ez muoz sîn spricht (vgl. Anm. 268): Wenn dieser Gott, da man über ihn in Zweifel fallen kann, nicht nach einem unpersönlichen Gesetz Heil und Unheil zugleich in sich bergen kann, sondern ein persönlicher Gott sein muss, dessen Personsein durch keine Macht eingeschränkt wird, wenn dieser Gott also absolut frei sein muss, so ist der Mensch, da er durch seinen Willen nie den Willen Gottes einschränken könnte (vgl. o. S. 15), vollkommen in Gottes Hand gegeben, und also ist der Wille Gottes für den Menschen notwendiges Gesetz: was Gott will, das m u s s am Menschen geschehen (vgl. o. S. 15 f.), und wie Gott will, so geschieht es, als liep und als leit. Das muoz sagt also nur etwas über das Geschick des Menschen, nichts über die Art des Schickenden: Gott ist nicht von ihm betroffen(224). Der Mensch muss leiden, wenn Gott ihm Leid schickt (vgl. o. S. 23), nicht aber muss Gott notwendig Leid schicken; dies liegt nicht in seinem Wesen.
Von daher aber wird noch einmal die Eigenart christlicher Tragik deutlich (vgl. o. S. 17 f.): Wenn Gott nicht unter einem tragischen Gesetz steht und darum nicht notwendig Leid schicken m u s s, so bestehen zwar „im Christlichen alle Phänomene des Tragischen weiter, aber die Sinn- und Ausweglosigkeit der Tragik hört auf"(225): der absolut freie Gott kann dem Unglück Sinn und Ziel geben, und er tut es, da er gütig ist. Das Tragische bestimmt also nicht das Ganze des Seins, sondern bleibt beschränkt auf die einzelne Situation.
Tragisch aber ist diese Situation, obwohl sie einer umfassenden Ordnung untergeordnet ist, sofern der Mensch nicht freiwillig diese Situation herbeigeführt hat, sondern durch sein Wesen in sie hineingezwungen wurde: nichtig (86) durch seine Herkunft, darum ohne die rechte Sicht, fällt er in Schuld und Leid. Der so aus seinem Wesen heraus sich ständig vergehen Könnende und sich, wenn ihn Gott seiner Nichtigkeit überlässt, tatsächlich auch Vergehende sieht keinen Ausweg: der Ausblick auf eine Sinngebung durch die Güte eines freien persönlichen Gottes ist ihm verstellt, weil ihm der Blick in die Zukunft verwehrt ist; so wird ihm das Tun Gottes unbegreiflich; der Zweifel an Gottes Güte wird zur Verzweiflung - auch dies meint Wolfram mit zwîvel (226).
An dieser Stelle wird die Beziehung zwischen Glaube, tragischer Weltsicht und Verzweiflung deutlich: Nicht wird der Glaube erschüttert angesichts des tragischen Leids in der Welt - der Gläubige nimmt sein Kreuz auf sich, da es von Gott geschickt ist -, sondern erst, wo der Glaube erschüttert ist, wird der Blick für das Tragische des Leids so hell, dass der Mensch verzweifelt, weil er das Tragische nicht mehr innerhalb einer sinnvollen Ordnung deuten kann. Denn der Mensch, der ganz zur Erkenntnis seines Elends gelangt, ohne Gott zu erkennen, endet in Verzweiflung (Pascal). Verzweifelt sein heißt also für Wolfram: ohne Gott leben, von Gott verlassen ganz der eigenen Nichtigkeit, Sterblichkeit verfallen sein, heißt tot sein und heißt auch: dem Nichtwissen ausgeliefert sein und darum, seinen Aufenthaltsbereich verkennend, von Gott abfallen (vgl. o. S. 14), sich ihm gleichsetzen:
hât er haz, den wil ich tragn (332,8).
Das Motiv der Verzweiflung in der Bibel
Parzival hat also wenig Ähnlichkeit mit den tragischen Helden der griechischen Tragödie oder auch des germanischen Heldenlieds; diese Helden wissen um die Unerbittlichkeit des Schicksals und kennen darum nicht die Verzweiflung, wie sie Parzival kennt. Nur dort, wo an einen allmächtigen, gerechten und gütigen Gott als das höchste Weltprinzip geglaubt wird, ist eine solche Verzweiflung denkbar. Vorbilder für Wolfram sind also in der christlichen Tradition zu suchen, z. B. im Alten Testament, und zwar erst in den Texten der Zeit, in der das Leid des Einzelnen nicht mehr in eine Kollektivschuld eingebettet gesehen wird(227). Kann dem Einzelnen nicht mehr die Schuld anderer zugerechnet werden, so empört sich dieser, da er nun beurteilen kann, ob er schuldig ist oder nicht, gegen das Leid, das ihn als Unschuldigen trifft: Non est aequa via Domini - Der Weg des Herrn ist nicht gerecht (Hes 18,25,29), und diese Empörung (das Murren des Volkes Israel) wird zu einem unüberhörbaren Leitmotiv im Allen Testament, das im Ps. 88 eine seiner prägnantesten Ausformungen erhalten hat: „Herr, Gott meines Heils, Tag und Nacht schreie ich vor dir, denn meine Seele ist voll von Leid, und mein Leben hat sich der Unterwelt genaht . . . Ich gleiche dem Menschen, den man verlassen hat . . ., den Erschlagenen (87) gleiche ich, die in den Gräbern schlafen, deren du nicht länger gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind ... Deine Wut lastet schwer auf mir, und mit all deinen Fluten hast du mich erdrückt. Entfremdet hast du mir meine Freunde . . . Ich habe, Herr, zu dir gerufen jeden Tag, meine Hände zu dir ausgebreitet." Und in einer ironischen Frage gipfelt der Trotz, die Empörung, die Verzweiflung: „Du wirst doch nicht an den Toten Wunder tun? (deren Gott nicht länger gedenkt) ... Man wird doch nicht im Grabe erst von deiner Güte sprechen und von deiner Treue nur im Verderben? Man wird doch nicht deine Wundertaten erst in der Finsternis erkennen und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens?"(228); in einem Land also, wo Güte und Treue, Gerechtigkeit und Wundertaten nicht mehr nützen (229). Dieser Text kennzeichnet auch Parzivals Verlassenheit nach der Verfluchung. Ob Wolfram ihn kannte, darüber kann man nur Vermutungen anstellen.
Sicher kannte er die Worte des alttestamentlichen Psalms, mit denen Christus seine Verzweiflung herausschreit: »Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"(230); und er mag an sie gedacht haben, als er Parzivals Klage schrieb, eine männlich-trotzige Variation dieses Christusworts, die Klage darüber, dass ein (scheinbar) treuloser Gott den verlassen hat, der ihm immer treu gewesen ist.
Die höchste Steigerung erreichen Klage und Empörung im Buch Hiob; und Hiobs Problem gleicht genau dem Parzivals: „Unverständliches, Unrecht ist geschehen an Ijjob, und Gott hat es selber getan - wer anders, wenn er der Allwirkende ist? Und ist er der Allgerechte - warum?"(231)
Vergleich zwischen Parzival und Hiob
Wer innerhalb des jüdisch-christlichen Kulturkreises, solange dessen religiöse und theologische Vorstellungen noch lebendig im Zentrum stehen, in dieser unorthodoxen Weise, wie Wolfram es tat, nach dem Übel in der Welt fragt, von dem ist zu vermuten, dass er aus Selbstbetroffenheit fragt; zudem findet sich gerade im ‚Parzival’ so viel Lebendig-Individuelles, so viel Engagement, dass diese Vermutung auch für Wolfram gelten kann (232). Dass Wolfram Chrestien nachgedichtet hat, widerspricht nicht dieser Vermutung - die neuzeitliche Vorstellung von Originalität darf nicht dazu verleiten, dem Nachdichtenden Eigenständigkeit abzusprechen. Der Vergleich mit der Vorlage macht deutlich, dass Wolfram in keiner Weise durch Chrestien gehindert wurde, seine Dichtung von diesem Selbstbetroffensein bestimmen zu lassen. Doch damit die Erfahrung eines Einzelnen sich in einer Dichtung artikulieren kann, muss der Dichter sich diese Erfahrung bewusst machen können mit Hilfe der Sprache, d. h. er muss an eine Tradition anknüpfen können, die wenigstens annähernd Ähnliches schon in Worte gefasst hat.
(88) In der zeitgenössischen Theologie und Dichtung konnte der Dichter des ,Parzival’ sein Problem - das des unschuldig leidenden Menschen - kaum finden; das Leid des Perceval z. B. ist nicht das Leid des Unschuldigen, sondern Perceval wird durch sein Leid für eine konkret fassbare Schuld bestraft (vgl. o. S. 9 f.; 20 f.). Darum auch steht im ‚Perceval’ nichts von einer Rebellion gegen Gott.
Es gibt ein Werk, das Wolfram gekannt haben könnte und das in ähnlicher Weise wie der ‚Parzival’ die Frage nach dem Leid des Unschuldigen stellt: das Buch Hiob. Wenn Wolfram das Buch gekannt hat - und ich unterstelle dies im folgenden als Arbeitshypothese -(233), so war es naheliegend, die Problematik dieses Buches in die Form umzusetzen, die sich dem Dichter des 13. Jhs. am ehesten anbot: in die des Artusromans; denn das im Buch Hiob dargestellte Schicksal - Glück, Leid und endgültige Erhöhung - entspricht genau dem Handlungsverlauf der Artusromane. So könnte man Parzival, den Gott bevorzugt, dann verlassen und schließlich wieder in seine Gnade auf genommen hat, einen Hiob in ritterlich-höfischem Gewand nennen.
Die Parallele Hiob-Parzival ist freilich nur unter der Voraussetzung denkbar, dass Wolfram sich frei machen konnte von der durch den Kommentar Gregors d. Gr. bestimmten Vorstellung vom geduldigen Hiob, wie sie allenthalben, z. B. auch: bei Hartmann, zu finden ist: Der arme Heinrich, vom Aussatz befallen, wird mit Hiob verglichen:
dô schiet in sîn bitter leit
von Jôbes geduldikeit.
wan ez leit Jôb der guote
mit geduldigem muote,
dôz im ze lîdenne geschach,
durch der sêle gemach
den siechtuom und die swacheit
die er von der werlte leit:
des lobete er got und vreute sich (137-145) (234).
Hartmann sieht also nur den gehorsamen, gläubigen Hiob, der angesichts seines Leids nichts sagt als: Dominus dedit, Dommus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum. (1,21) Doch dieser Hiob ändert sich, nachdem seine Freunde sieben Tage bei ihm gesessen haben; er ändert sich so sehr und steht in einem solchen Gegensatz zum geduldigen Hiob der Vorgeschichte, dass die Textkritiker ihn nicht mehr als denselben erkennen und von verschiedenen Überlieferungsschichten sprechen. Gerade aber diesem verwandelten Hiob, dem Hiob, der mit Gott wegen seines Leids rechtet, der in ihm seinen Feind sieht und erst am Ende, nach langem Widerstand, sich fügt am Ende, nach langem Widerstand, sich fügt (40,4/5; 42,2/3), ist Parzival, der den
am Ende, nach langem Widerstand, sich fügt (40,4/5; 42,2/3), ist Parzival, der den haz Gottes tragn wil, verwandt.
(89) Ursache des Streits ist im ,Parzival’ ebenso wie im Buch Hiob, dass das Treueverhältnis zwischen dem Menschen und Gott gestört erscheint. In beiden Fällen hat sich Gott, so müssen die Betroffenen meinen, als untreu erwiesen, lebt der Mensch nicht so, wie er aufgrund seiner Treue zu Gott zu leben erwarten darf: Gott hat Parzival nicht geholfen, sondern ihn verlassen, und Gott hat auch Hiob das glückliche Leben verweigert, das dem, der wie Hiob recht, gerade, Gott fürchtend und fern vom Bösen lebt (1,1), zusteht - wenn Gott gerecht vergilt. Beide auch sind nicht etwa deshalb schuldig, weil es ungerechtfertigt wäre, für ein gutes Leben von Gott Lohn zu erwarten. Für Wolfram ist diese Frage, ob der Mensch von Gott den Lohn für seine Rechtschaffenheit erwarten darf, nie ein Problem gewesen, da er die triuwe von der Liebe her versteht (vgl. o. S. 48 f.); und es findet sich kein Vers im ,Parzival’, der ein solches Problem auch nur andeutet; im Buch Hiob versucht zwar der Satan, Gottes Ehre anzugreifen, indem er behauptet: nicht deinetwegen, sondern des Lohnes wegen, weil und solange du ihm Gutes erweist, fürchtet dich Hiob; er dient dir also nur, um sich deiner zu bedienen(235). Doch im Streit mit Gott und auch in der Lösung verschiebt sich dieses Problem entscheidend: Es geht nicht mehr um ein do ut des, nicht mehr darum, um seiner selbst willen anstatt um seiner Gaben willen geehrt zu werden; die Ehre Gottes wird in einer viel entschiedeneren Weise in Frage gestellt: Gott hat in den Augen Hiobs seine Ehre verloren, weil dieser Gott ungerecht und böse zu sein scheint, indem er den Menschen, der gerecht lebt, nicht leben lässt. Gott ist ungerecht, da er sich nicht an die Verheißungen hält, die er gegeben hat, da er nicht den Guten Gutes und den Bösen Böses tut, wie er versprochen hat, und zwar hier und jetzt - eine Hoffnung auf das jede Ungerechtigkeit ausgleichende Jenseits kennt Hiob nicht (236) und ist auch für Wolfram kein Ausweg(237). Es herrscht also ein ungeheurer Widerspruch zwischen dem Gott, der Gerechtigkeit versprochen hat und Hilfe dem Guten (vgl. o. S. 47), der als der gütige und gerechte dem Kind Parzival verheißen wurde(238), und dem, der als der Allwirkende die leidvolle, böse Wirklichkeit bewirkt, der Ursache des Bösen ist, der die Bösen belohnt und die Guten ins Leid schickt (Hiob 21,7 ff.; vgl. Jer 12,1-3; Ps 73,3). Ungeheuer ist dieser Widerspruch, da es aus ihm keinen Ausweg gibt, nicht den, dass Gott durch ein böses Prinzip außer ihm begrenzt wird, noch den, dass hinter Gott ein unpersönliches Fatum steht, und sicher nicht den, dass es diesen Gott gar nicht gibt. Diesen Widerspruch auszuhalten, ist beider, Hiobs und Parzivals, Aufgabe, die begleitet ist vom Zweifel an diesem Gott, die scheitert, wenn sie in Verzweiflung, und die gelingt, wenn sie im Glauben endet, im Glauben an nicht mehr Begreifbares. Und es zeugt von höchster Verzweiflung und tiefstem Glauben zugleich, dass Hiob, da niemand sonst etwas gegen Gott vermag, den Gott der Verheißungen anfleht, ihm beizustehen gegen den Gott, der sich ihm in der Wirklichkeit zeigt: Gott soll Gottes Bild in Hiobs Seele retten(239). Darum „drängt (Hiob) hin zu Gott, es ist ihm unter allen (90) Umständen um ein Gespräch mit Gott zu tun (6,29; 9,15f.,32f.; 13,3, 13-16,22)"(240). Und auch Parzival sagt Gott Feindschaft an und drängt doch zugleich auch zu ihm hin, sucht ihn ständig, ist immerfort und unermüdlich auf dem Weg zur Gralsburg(241), gibt Gott immer wieder eine Chance (242 (242a), sich als der zu erweisen, als der er ihm versprochen wurde. Und er hofft immer wieder, dass Gott sich als der Erlöser (Hiob 19,25-27) zeigt, der jenseits des Begreifens das Bild des treuen Gottes in seiner Seele rettet, der wider aller Erfahrung sich als treu erweist:
er sprach ,waz ob got helfe phligt,
diu mînem trûren an gesigt?
wart ab er ie ritter holt,
gedient ie ritter sînen solt,
ode mac schilt unde swert
sîner helfe sîn sô wert,
und rehtiu manlîchiu wer,
daz sîn helfe mich vor sorgen ner,
ist hiut sîn helflîcher tac,
sô helfe er, ob er helfen mac.’ (451,13-77) (242b)
Die drei Freunde - Trevrizent; Vergleich
Gottes Bild retten wollen auch die drei Freunde Hiobs. Sie aber gehen einen anderen Weg: Sie sehen einen Menschen im Leid - mit dieser Tatsache haben sie sich auseinanderzusetzen. Damit aber Gott nicht ungerecht erscheint, als Tyrann, dessen Willkür die Menschen ausgeliefert sind - so muss er zunächst erscheinen, wenn der Mensch unschuldig leidet -, deuten sie das Leid als Strafe für Sünde. Nicht Gott, sondern der sündige Mensch ist die eigentliche Ursache des Übels: „... selber zeugt der Mensch die Pein"(243). Wenn also Hiob Sünder ist, so ist die Ehre Gottes wieder hergestellt.
Diese Sündenlehre ist die gleiche, mit der sich Wolfram auseinanderzusetzen hat (vgl. o. S. 20). Als Parzival, bedrückt durch das Wissen um seine Verfehlung auf der Gralsburg, aber mit dem Bewusstsein seiner Unschuld, zu Trevrizent kommt und dieser ihn überzeugen will, dass er sich durch seine Verfehlung strafbar schuldig gemacht habe, scheint mir etwas von dieser Auseinandersetzung spürbar zu werden.
Das Gespräch zwischen Trevrizent und Parzival kann freilich nicht als eindeutiges theologisches Streitgespräch interpretiert werden, denn es ist nicht nur als Gegeneinander, sondern auch als Miteinander zu verstehen: Trevrizent verhilft Parzival dazu, seinen Standort genauer zu erkennen. Zudem ist es innerhalb des Romans zu sehr als Darstellung eines echten, lebendigen Gesprächs konzipiert, als dass begriffliche Eindeutigkeit erwartet (91) werden könnte. Im Gegenteil: Wolfram benutzt hier, so meine ich, ein Kunstmittel, mit dem er die Eigenart eines solchen Gesprächs verdeutlichen kann und das zugleich dem Gespräch die begriffliche Exaktheit nimmt: er gebraucht dasselbe Wort in verschiedener Sinnfärbung(244). sünde z. B. bedeutet in diesem Gespräch sowohl ,objektive Verfehlung’ (bei Parzival) als auch ‚strafbarer Ungehorsam gegen die göttliche Ordnung’ (245) (bei Trevrizent). riuwe versteht Parzival als Schmerz über die Folgen seiner Verfehlung, Trevrizent auch als ,Reue’ (z. B. 466,11/12); d. h. er versteht unter riuwe, dass der Schuldige die Schuld auf sich nimmt, zur Buße bereit ist und das dieser Schuld folgende Leid anerkennt.
Wenn durch eine Interpretation die Möglichkeit, in diesem Gespräch dieselben Wörter verschieden zu verstehen, deutlich geworden ist, wird man neben dem Miteinander der beiden Sprechenden auch das Gegeneinander erkennen. Dieses Gegeneinander möchte ich bei der folgenden Untersuchung des Gesprächs besonders betonen. Ist durch diese Akzentuierung der Verschiedenheit deutlich geworden, dass Trevrizent aus einer Haltung heraus spricht, die im Menschen den strafwürdigen Sünder sieht, so kann auch die Beziehung zwischen Trevrizent und den drei Freunden Hiobs hergestellt werden.
Schon der Beginn des Gesprächs deutet auf diese Haltung Trevrizents hin: Trevrizent wirft Parzival vor, er trage am Karfreitag die Rüstung:
so stüende iu baz ein ander wât,
lieze iuch hôchferte rât (456,11/12).
Von Gabenis, der nicht anders denkt als Trevrizent, hat Parzival erfahren, was Trevrizent mit hôchvart meint:
unrehte iu denne dez harnasch stêt.
ez ist hiute der karfrîtac (448,6/7).
Am Karfreitag aber habe Christus die Menschen durch seinen Tod von der Sünde losgekauft (448,14):
er hât sîn werdeclîchez leben
mit tôt für unser schult gegebn,
durch daz der mensche was verlorn,
durch schulde hin zer helle erkorn.
ob ir niht ein heiden sît,
sô denket, hêrre, an dise zît.
rîtet fürbaz ûf unser spor.
iu ensitzet niht ze verre vor
ein heilec man: der gît iu rât,
wandel für iwer missetât,
welt ir im riwe künden,
er scheidet iuch von sünden (448,15-26).(245a)
(92) Parzival soll also bei Trevrizent die Entheiligung des Karfreitags als Zeichen seines Hochmuts bereuen und büßen, obwohl er für diese sünde nicht verantwortlich ist:
swie die tage sint genant,
daz ist mir allez unbekant (447,23/24).
Sogleich nach der Ankunft bei Trevrizent will Parzival sich sein Leid vom Herzen reden:
nu hân ich sorgen mêre
denne ir an manne ie wart gesehn (460,14/15);
. . . mirst freude ein troum:
ich trage der riwe swaeren soum (461,1/2);
und er spricht von seinem haz gegen den Gott (461,9), der ihn ohne Berechtigung ins Leid habe fallen lassen:
daz diu riuwe ir scharpfen kranz
mir setzet ûf werdekeit
die schildes ambet mir erstreit (461,18-20).
Trevrizent aber verteidigt Gott gegen diese Anklage
. . . hêrre, habt ir sin,
sô schult ir got getrûwen wol:
er hilft iu, wand er helfen sol (461,28-30) – (245b)
,er hilft Euch, weil er zur Hilfe verpflichtet ist durch seine triuwe' (ern kan an niemen wenken; 462,28) (245c); wenn nun Gott Parzival in Leid geführt habe, so sei er auch dazu verpflichtet und berechtigt gewesen. Trevrizent kann sich also Parzivals Leid nicht anders erklären, als dass Parzival durch dieses Leid für irgendeine Schuld gestraft werde; und Trevrizent will die Sünden wissen, für die Parzival gestraft worden sei:
sagt mir mit kiuschen witzen,(245d)
wie der zorn sich an gevienc,
da von got iwern haz enpfienc (462,4-6).
Später, als Trevrizent erfährt, dass Parzival Schuld hat am Tode Ithers und der Mutter und dass er der unsaelec barn (488,19) ist, der die Gralsfrage versäumte, da weiß Trevrizent auch, warum Parzival leidet; von dem, der die Frage versäumte, hatte Trevrizent zuvor gesagt:
doch muoz er sünde engelten,(245e)
daz er niht frâgte des wirtes schaden (473,18/19).
Eindeutig ist ihm Parzivals Leid Strafe für Parzivals Sünden, selbst schon dann, als er von Parzivals Verfehlungen noch nichts Konkretes weiß; und darum muss er die Überzeugung Parzivals, er sei schuldlos an seinem Leid, als superbia verurteilen: (93)
wan der sîn leit sô richtet
daz er unkiusche sprichet,
von des lône tuon i’u kunt,
in urteilt sîn selbes munt (465,15-18).
Er erinnert an den Hochmut und den Fall Luzifers, Adams und Kains, fordert Buße (465,13; 466,13), warnt vor weiterer Sünde (465,14) und droht mit Strafe für den, der seine Sünden nicht bekennt und bereut (465,30; 466,11/12; 467,8), all dies, bevor Parzival überhaupt dazu gekommen ist, eine
grôze sünde zu bekennen. Doch diese Worte treffen Parzival nicht. Was Trevrizent ihm über Gottes Hilfe und triuwe gesagt hat, ist ihm wie jedem mittelalterlichen Menschen selbstverständlicher Besitz: dass Gott hilft, weil er helfen muss, dass Gott nihtes ungelônet lât, / der missewende noch der tugent (467,14/15). Doch nachdrücklich wehrt er sich dagegen, dass sein Leid als Strafe für missewende interpretiert wird. Sein Leid ist für ihn nicht Sündenstrafe, sondern Zeugnis der Ungerechtigkeit seines Geschicks:
ich hân mit sorgen mîne jugent
alsus brâht an disen tac,
daz ich durch triwe kumbers pflac (467,16-18).
Parzival erkennt deutlich das Tragische seiner Situation (vgl. o. S. 57); Trevrizent aber hört nur das Wort kumber, verknüpft es nun nicht mit triuwe, sondern mit sünde:
. . . gern ich vernim
waz ir kumbers unde sünden hât (467,20/21).
Parzival aber, weil er sich keiner Schuld bewusst ist, antwortet nicht auf die Frage nach der Sünde, sondern nur auf die nach dem kumber:
mîn hôstiu nôt ist umben grâl;
dâ nâch umb mîn selbes wîp (467,26/27).
Doch Trevrizent kommt noch einmal auf das Ursache-Folge-Verhältnis zurück, in dem seiner Meinung nach sünde und kumber stehen; von den Gralsrittern glaubt er:
swâ si kumbr od prîs bejagent,
für ir sünde si daz tragent (468,29/30; vgl. 492,9/10).
Aus Trevrizents erstem Bericht über den Gral entnimmt Parzival, dass er die Tauglichkeiten eines Gralsritters besitzt und dass er gerechterweise zum Gralsritter berufen werden sollte (472,1-11). Doch Trevrizent vermisst die bußfertige Gesinnung und kann aus Parzivals Worten nur Hochmut hören (472,11-17); darum erzählt er ihm zur Warnung von der hôchvart des Anfortas.
Wie sehr das Gespräch bisher ein Gegeneinander gewesen ist, wird offenbar, als Trevrizent Parzival verdächtigt, er sei jener Lähelin, der einen Gralsritter erschlagen hat; das Gralspferd aber, das Parzival reitet – seinet(94)wegen hatte Trevrizent Parzival verdächtigt -, hätte ihm auch Zeichen sein können, dass Parzival sich mit der Hilfe Gottes den Weg zum Gral erkämpft.
Parzivals Bekenntnis, mit dem er zu Trevrizent gekommen ist: er sei ein man der sünde hât (456,30), stünde im Widerspruch zur Verteidigung seiner Unschuld, wenn nicht sünde hier im Sinne einer objektiven und nicht im Sinne einer subjektiven Verschuldung gemeint wäre. Da Trevrizent Parzivals Selbstverteidigung nur als trotzigen Übermut gegen Gott versteht, muss für ihn das Wort sünde eine andere Bedeutung haben als für Parzival. So auch, als Parzival die sünde (475,8) des rêroup (245f)
berichtet, die er aber an den witzen toup (475,6) begangen habe. Trevrizent nun rechnet ihm diese Verfehlung und den Tod Ithers als Schuld zu, preist, um die Größe dieser sünde des Brudermords ins hellste Licht zu rücken, Ither überschwenglich (475,27-476,11) und meint, wenn Gott gerechter als gütig sei, müsse Parzival als Entgelt sein Leben geben, und Parzival solle sich besinnen, welche Buße er als Ersatz geben könne (475,22-26). Schließlich wirft Trevrizent Parzival noch die Schuld am Tod der Mutter vor (476,11/12). Parzival ist so entsetzt (neinâ hêrre guoter, / waz sagt ir nu?; 476,14/15) (245g, dass nicht einmal die Gralskönigswürde ihn über das Unheil trösten könnte, und er will nicht glauben, dass Ither sein Blutsverwandter war und dass seine Mutter durch ihn gestorben ist:
sint disiu maere beidiu wâr? (476,22).
Doch dieses Entsetzen, das deutlich Parzivals Unschuld bezeugt, überhört Trevrizent und stößt Parzival mit dem ungeheuerlichen Wort zurück:
du waer daz tier daz sie dâ souc,
unt der trache der von ir dâ flouc (476,27/28).
Da Parzival sich nun so schuldbeladen dastehen sieht; da es ihn drängt, sich auch noch die Verfehlung vom Herzen zu reden, die ihn vor der Nachricht über Ither und den Tod der Mutter am meisten belastet hatte; da er hofft - durch die Gutherzigkeit, mit der Trevrizent ihn und sein Pferd versorgt, ermutigt (488,7/8) -, Trevrizent habe nun eingesehen, dass er unschuldig sei an seiner Schuld, und werde dieses Mal nicht von Vergeltung sprechen (488,10), sondern mit ihm klagen über das Leid, das er ohne sein Wollen verschuldet hat, so gesteht er nun auch seine tumpheit auf der Gralsburg (488,4-20).
Trevrizent reagiert nun auch wirklich anders als bisher. Zwar macht er immer noch Parzival für dieses Tun verantwortlich:
. . . dîn kunst sich saelden sus verzêch (488,25); (245h)
doch er denkt daran, dass ja Parzival wie die ganze Menschheit (sie hât wilden art; 489,5) im Zustand der Sündenstrafe lebe (vgl. o. S. 19 f.), dass es also tumpheit sei, den, der in solchem art lebe, durch Vorwürfe noch in die (95) Judassünde der Verzweiflung über die Schuld zu stürzen. Er will ihn vor der sündhaften Hoffnungslosigkeit bewahren, angesichts der Schwere der Sünde nie mehr der Barmherzigkeit Gottes würdig zu sein. Als sündhaft wird diese Hoffnungslosigkeit in der Theologie bezeichnet, weil sie aus dem Bewusstsein kommt, „die eigene Sünde sei so groß, dass Gottes, des Allmächtigen, Gnade nicht ausreiche, sie zu löschen“. (246).
Um Parzival vor dieser Hoffnungslosigkeit zu bewahren, versucht Trevrizent, ihn zu trösten. Er kann nun darauf verzichten, auf Strafe und Buße hinzuweisen, da er glaubt, Parzival sei dadurch, dass er auf der Gralsburg versagt habe, genug gestraft.
So bietet er Parzival seinen rât als guten ‚Ersatz’ für den Gral an (489, 17-21) (247): Parzival solle nicht mehr weiter nach dem Gral suchen, sondern bescheiden bleiben, was er war: ein Artusritter. Zum Gral könne Parzival nicht kommen: Zwar seien auch die zum Gral Prädestinierten - wie alle Menschen - Sünder; doch diese Prädestination erweise sich schon dadurch, dass die Gralsritter anders als Parzival bußfertige Gesinnung besäßen; es seien Menschen mit
kiuscheclîchen güeten (493,24), vor allem aber seien sie vor sündebaeren schanden / . . . immer mêr behuot (471,10/11). Parzivals Sünden aber haben in Trevrizents Augen ein so großes Gewicht, dass er nicht glaubt, Gott könne einen solchen Menschen zum Gral berufen: Parzivals Absicht, die Gralsburg zu finden, ist ihm Torheit (468,11-14), und dass Parzival dort versagt hat, ist ihm Beweis genug, dass er nicht benennet (473,12) sei (248):
der selbe was ein tumber man
und fuorte ouch sünde mit im dan (473,13/14).
Wegen dieser Sünde glaubt Trevrizent, Parzival trösten zu müssen, um ihn vor endgültiger Verzweiflung zu bewahren. Parzival aber hatte anderen Trost erwartet. Er kann Trevrizent zustimmen, wenn dieser über die durch den Sündenfall verderbte Welt klagt, in der der Mensch in Schuld und Leid fällt (249 249a. Doch das Mitleid, das Trevrizent ihm im Blick auf eine solche Welt entgegenbringt, ist ein Mitleid mit dem zwar armseligen, aber doch strafwürdigen Sünder. Ein solches Mitleid, das durch den Hinweis auf die Strafwürdigkeit der sündhaften Grundverfassung des Menschen getrübt ist, ist aber der Situation Parzivals nicht angemessen. Angemessen ist ein Mitleid, das aus der Erkenntnis kommt, dass dem Menschen seine Verfehlung, die er ohne sein Wollen beging, in keiner Weise zugerechnet werden kann, auch nicht in der Weise, dass er, wenn schon nicht für seine persönliche Verfehlung, so doch für die ererbte Urschuld und somit für den unheilvollen Zustand der Welt mitverantwortlich sei.
Parzival behauptet gegenüber Trevrizent seine Unschuld, und weil er sich subjektiv frei von Schuld fühlt, verzweifelt er auch nicht über die Größe seiner Schuld, wie Trevrizent befürchtet, sondern darüber, dass er, wie er (96) glauben muss, nicht dorthin gelangt, wo allein er sein Heil zu finden glaubt: zum Gral. Wenn Parzival darauf beharrt, dass er trotz seiner Verfehlung zum Gralsrittertum bestimmt sein müsse, wenn Gott wîse sei, Trevrizent dagegen versucht, Parzival vom Gral ‚abzuleiten’, so offenbart sich das Kontroverse dieses Karfreitagsgesprächs in aller Deutlichkeit; vom Ende des Romans her zeigt sich auch, dass Wolfram in diesem Streit seinem Helden recht gibt: Parzival ist Gralskönig geworden; er ist der Meinung entgegengetreten, der Mensch vermöchte etwas aus eigener Kraft (sô hât got wol zuo mir getân; 783,10; vgl. weiter unten S. 109); er hat eine falsche Deutung seines Schicksals abgewiesen, indem er Trevrizents Worte nachdrücklich wiederholt hat:
daz den grâl ze keinen zîten
niemen möht erstrîten,
wan der von gote ist dar benant (786,5-7);
und dieses entschiedene Wort Parzivals ist überall bekannt geworden:
daz maere kom übr elliu lant,
kein strît (d. h. kein eigenmächtiges Bemühen) möht in
erwerben (786,8/9).
Es ist also kein Zweifel mehr daran möglich, dass Parzival in der Demut lebt. Und doch glaubt Trevrizent immer noch, Parzival sei voller hôchvart und er müsse ihn zur Demut bekehren (250):
nu kêrt an diemuot iwern sin (798,30).
Denn anstatt zu erkennen, dass Parzival nicht für Schuld gestraft worden ist, bleibt er bei seiner Überzeugung, jedes Leid sei Strafe für Schuld, für persönliche Schuld oder auch für die allgemeine Sündhaftigkeit der Menschheit. Da aber Parzival, den er für einen Sünder und darum nicht des Gralskönigtums für würdig hält, dennoch Gralskönig geworden ist, muss er nun glauben, Parzival habe Gott bezwungen (798,23-29), habe ihm das Gralskönigtum abgetrotzt. Und mit hintergründigem Humor lässt Wolfram Trevrizent feststellen, dass er einen Gott, der bei der Erlösung des Anfortas auf solch merkwürdigen Wegen seine helfende kraft erweise, nicht mehr verstehen kann (797,19-30).
Trevrizent hat bisher bei Parzival kein Zeichen von Zerknirschung gesehen. Deshalb versucht er am Ende des Karfreitagsgesprächs noch einmal nachdrücklich, Parzival zur Bußfertigkeit und Zerknirschung zu führen, da er ja glaubt, Gott werde in seiner unendlichen Langmut und Güte dem Bußfertigen in jedem Fall verzeihen. Damit Parzival nicht in seiner Verstocktheit verharre, erinnert er ihn an seine grôze sünde (499,20) und an den Gott der Vergeltung (499,16).
Ein letztes Mal noch weist Trevrizent Parzival darauf hin, wie verfehlt es sei, dass ein solch sündiger Mensch wie Parzival den Gral zu finden hoffe: Parzival hatte, von einem Gralsritter angegriffen, sein Pferd verloren. (97) Da der Gralsritter nach der ersten Tjoste geflohen war und sein Pferd im Stich gelassen hatte, hatte Parzival es an sich genommen. Trevrizent wirft nun Parzival vor, er habe den Gral beraubt. Wenn Parzival aber so handle und noch glaube, er könne je Glied der Gralsgemeinschaft werden,
sô zweient sich die sinne (500,18). Parzivals Antwort auf diesen Vorwurf zeigt noch einmal, dass es Trevrizent nicht gelungen ist, Parzival zur Einsicht in die Sündhaftigkeit und Strafbarkeit seines bisherigen Lebensweges zu bringen. Denn Parzival wehrt sich heftig gegen die Anschuldigung Trevrizents:
swer mir dar umbe sünde gît,
der prüeve alrêrste wie diu stê (500,20/21).
Und Trevrizent weiß mit nichts anderem zu entgegnen als mit einer erneuten Beteuerung von Parzivals Schuldhaftigkeit (501,1-5).
Trevrizent hat Parzival nicht zu bußfertiger Gesinnung führen können: Parzival sagt nicht, wie Perceval es entschieden tut, Ja zur Buße, er umfasst nicht wie Perceval voller Reue die Füße des Einsiedlers und weint auch nicht in Zerknirschung viele Tränen (251). Das Kontroverse des Gesprächs bleibt bestehen; darum fordert Wolfram am Ende des 9. Buchs den Leser ausdrücklich auf, die Haltungen der beiden zu überdenken:von ein ander schieden sie:
ob ir welt, sô prüevet wie (502,29/30).
Für die Lösung von Parzivals Problem, mit dem er zu Trevrizent gekommen war: das menschliche Leid mit der Allmacht und Güte Gottes in Einklang zu bringen, gibt es innerhalb der christlichen Theologie zwei Möglichkeiten: Entweder entlastet man Gott und spricht dem Menschen das Übel in der Welt zu, oder man entlastet den Menschen und spricht die Ursache Gott zu. Trevrizent versucht Gott zu entlasten und damit verstehbarer zu machen, indem er Parzival für seine Verfehlungen und deren Folgen verantwortlich macht. Im Buch Hiob entspricht dieser Haltung die der drei Freunde. Auch den drei Freunden geht es zunächst um den Leidenden; sie wollen ihn trösten mit ‚Gottes Tröstungen’, die ein ‚sanftes Wort’ sind (15,11; vgl. 16,2), sie wollen einen Ausweg zeigen aus der Verzweiflung. Die gleiche Absicht hat Trevrizent; durch diese Freundlichkeit kann Parzivals getriwe minne erklärt werden, dier gein sînem wirte truoc (486,14/15.
Auch das Menschenbild der Freunde Eliphas, Bildad und Zophar entspricht dem Trevrizents: Sie sprechen von der Nichtigkeit des Menschen (15,14-16), von der allgemeinen Sündhaftigkeit der Welt: omnis homo peccator (4,17-19; 25,4-6); die Wurzel der Sündhaftigkeit sei der Hochmut des Menschen (8,2; 20,6). Der Mensch, so sagen die Freunde zu Hiob, sei sündig, und darum werde er bestraft, sein Leid sei ein gerechtes Gericht (4,8/9; 20,5-29); und wenn Hiob nichts von Schuld wisse, so sei er, da er ja leide, (98) unbewusst schuldig geworden (11,5-12). Wenn aber der Mensch seine Sünden bereue und büße, könne er noch das Heil erlangen(252); auch könne die Strafe zur Besserung führen (5,17/18). Darum solle Hiob seine Sündhaftigkeit eingestehen (5,8), sein Leid als Strafe anerkennen.
Je mehr aber Hiob sich gegen die Anschuldigungen wehrt, je mehr er also Gott verantwortlich macht und ihn anklagt, desto heftiger verteidigen die drei Freunde Gott; sie scheuen sich nicht, Hiob alle Schlechtigkeiten zu unterstellen, wenn nur Gott gerecht bleibt (5,9-16; 8,20).
Diese Auseinandersetzung wird dadurch verschärft, dass Hiob bzw. Parzival zunächst die extreme Gegenposition einnehmen: „Der Allgerechte vergreife sich am Gerechten"(253). Denn auch in dieser Position liegt keine gültige Aussage über Gott. Doch wenn sie auch nicht die Wirklichkeit Gottes erkennen, so erfassen sie immerhin die Wirklichkeit dieser Welt (254), denn es ist Wirklichkeit, dass sie unschuldig leiden; und das wenigstens wissen sie(255) (Hiob 6,24; 9,21; 10,2; 16,17; 27,2-5; 31,5/6).
Das Argument aber, mit dem die Freunde Gott frei und Hiob schuldig sprechen wollen, dass nämlich kein Mensch vor Gott gerecht sei (vgl. o. S 97), nutzt Hiob zu seiner Verteidigung: auch er weiß, dass er nicht ohne Sünde ist (9,2; 13,23-26; 14,4), doch dieser „status impuritatis„ - so plädiert er – „hafte am Menschen als geschöpfliche, und darum . . . unverschuldete Eigenschaft. Und wenn die kleine, dergestalt fehlsam geschaffene Kreatur(256) wirklich fehlt, was für ein Recht hat dann ihr Schöpfer, ein groß Wesen darob zu machen?
Fehl ich, was tu ich dir,
Menschenherzens Bildner du? (7,20)
Behagts dir, dass Gewalt du übst,
verwirfst das Mühwerk deiner Hände? (10,3)" (257)
Dass aber Hiob im Recht ist, wenn er seine Unschuld beteuert, hat Gott selbst bestätigt: „Denn keinen gibts auf Erden gleich ihm: recht und gerad, Gott fürchtend und fern vom Bösen." (1,8; vgl. Hes 14,14 ff.) (258)
Es wurde oben dargelegt, dass auch Parzival subjektiv unschuldig ist und dass er sich wie Hiob frei weiß von solcher Schuld, die aus freier Verantwortung entstanden ist, da er seine Verfehlungen aus tumpheit (vgl. Hiob 19,4: ignorantia) begangen hat. Und er empört sich darüber, dass Gott ihn dieser tumpbeit ausgeliefert hat.
Das neue Gottesbild
Vor seinem Leid war Gott mit Hiob gewesen (29,4 f.), und Hiob hatte ein Leben im Recht führen können: er hatte den Bedrängten geholfen (29,12-17; 31,16-22) und war geehrt gewesen (29,21-25). Diese seine Unschuld und seine Trefflichkeit geben ihm den Mut, gegen Gott einen Prozess zu führen, (99) mit ihm wegen seines Leids zu rechten: dass Gott ihn mit Unehre (17,6/7; 19,9; 30,1 ff.), Freudlosigkeit, Einsamkeit (19,6; 30,16,18 ff.) heimgesucht, dass er ihn grundlos vernichtet und sich so als treulos erwiesen habe (30,21, 26).
Und auch Parzival rühmt sich mit der für Wolframs Zeit typischen Unbekümmertheit seiner Tauglichkeit:
ist got an strîte wîse,
der sol mich dar benennen (472,8/9).
Und wie es bei Hiob geschieht, gibt ihm das Bewusstsein seiner Trefflichkeit den Mut (159), gegen den Gott anzutreten, der so treulos an ihm gehandelt habe; es gibt ihm aber auch den Mut, den Gott der triuwe zu suchen, dass er ihm Recht gebe gegen den Gott, der haz hat: deus contra deum (vgl. o. S. 89 f.).
Diese Paradoxie durchzustehen; des Menschen Unschuld zu behaupten, die Schuld Gott zu geben, zugleich aber Gott als Retter, als Erlöser zu sehen, dies ist die große Leistung Wolframs und des Verfassers des Buches ‚Hiob’, denn sie führt aus der Enge heraus, in der die Freunde und Trevrizent stehen, und führt zu einem Gottesbild, das eine humanere Interpretation des Menschlichen zulässt:
Die Vorstellung, dass Gott den Unschuldigen leiden lässt, lag außerhalb des Horizonts dieser Vertreter der Gerechtigkeitstheologie; sie anerkannten Gott also nur unter der Bedingung, dass dieser Gott gut und gerecht sei. So aber schränkten sie Gott in unzulässiger Weise ein, beraubten ihn seiner Absolutheit(260). Ihre rhetorische Frage: „Bedenk doch, welcher Reine ging zugrund, / wo sind Redliche verdorben?„ (4,7) (261) band Gott an die Bedingung der Gerechtigkeit. Mit dieser Begrenzung Gottes, dieser Verstellung des Gottesbildes aber wurde zugleich das Menschenbild entwürdigt, denn wenn kein Redlicher zugrunde geht, so ist der, der zugrunde geht, nicht redlich - und er wird verurteilt. Weil aber dieses Urteil über Gott und den Menschen falsch ist, zürnt Gott den Freunden: ‚Denn ihr spracht vor mir nicht das Rechte wie mein Knecht Hiob’ - quoniam non estis locuti coram me rectum, sicut servus meus Job (42,7).
Hiob also sprach das Rechte: Er verzichtet zwar nicht auf die Gerechtigkeit Gottes, doch er verzichtet ebenfalls nicht auf die Redlichkeit, Unschuld des Menschen, und eben dadurch kommt er dazu, den wirklichen, die Wirklichkeit bewirkenden Gott tiefer zu fassen: Gott ist gerecht und zugleich nicht gebunden an Gerechtigkeit, er ist gut und absolut zugleich. Und so kann Hiob in der Verzweiflung den gerechten gegen den absoluten Gott anrufen, im Glauben aber beide Seiten Gottes als Einheit fassen wie Jahrhunderte später Paulus, dem im Glauben der Widerspruch sich aufhebt, dass von den Kindern Rebekkas, ehe sie geboren waren ‚und weder Gutes noch Böses getan hatten’(262), das jüngere bevorzugt wurde.(100)
Wie Eliphas, Bildad und Zophar wird auch Trevrizent zurechtgewiesen, indem Parzival entgegen Trevrizents Meinung Gralskönig wird. Auch Trevrizent sprach nicht die Wahrheit über Gott, weil er die Wahrheit über Parzival, weil er Parzivals Unschuld nicht einsehen wollte. Denn weil er Parzival für strafbar schuldig hält und weil er glaubt, dass Gott strafbare Schuld gerecht beurteilen wird, kann er nicht einsehen, dass Parzival je den Gral erreichen könnte, so wie er ja auch davon überzeugt ist, dass die Engel, „Die einstmals nicht gewagt zu rebellieren, / Noch treu zu bleiben . . . "(263), vom gerechten Gott bestraft worden seien. Diese Lehre von der strafenden Gerechtigkeit betont Trevrizent am Ende des Romans noch einmal nachdrücklich, indem er seine andere Version über diese Engel (,Ich weiß nicht, ob Gott ihnen gnädig war, vielleicht war er es’; 454,25/26; 471,23-25) Parzival gegenüber als Lüge bezeichnet:
ich louc durch ableitens list (798,6):
,damals sagte ich, Gott habe wohl in seiner Barmherzigkeit sich der Engel erbarmt, und ich sagte es, damit du nicht verzweifeltest, sondern voller Reue zu Gott zurückkehrtest und als rechter Ritter lebtest (489,13-19); jetzt aber, da ich dich nicht mehr zu trösten brauche, kann ich dir sagen, dass die Engel die strafende Gerechtigkeit Gottes erfahren haben, und ich meinte auch, dass du, da doch die Engel verdammt sind, gerechterweise nicht hättest Gralskönig werden können’.
nu ist ez anders umb iuch komn (798,28),
dies ist Trevrizents fassungsloses Eingeständnis, dass an seinem Bild von Gott irgend etwas falsch sein muss. Was da falsch war, erkennt Trevrizent bis ans Ende nicht: groezer wunder selten ie geschach (798,2), so interpretiert er Parzivals Weg zum Gral. Doch Parzival freizusprechen, um so wenigstens dessen Erhöhung, wenn auch nicht dessen Leid zu verstehen, dazu vermag er sich nicht durchzuringen, denn dann wäre Parzivals Leid ja ungerecht gewesen. Eher glaubt er, dass sich Gott habe übertölpeln lassen (vgl. o. S. 96).
Erkenntnis Gottes im Glauben
Die Vertreter der Gerechtigkeitstheologie haben den Prozess um Gottes Gerechtigkeit verloren; das neue Gottesbild hat sich durchgesetzt, das Bild des Gottes, der, weil er absolut ist, den Unschuldigen leiden lässt und doch auch gerecht ist. Einen solchen Gott kann der Mensch mit der Vernunft nicht begreifen; und so tritt an die Stelle der Vernunft der Glaube, der jenseits der Vernunft das Paradoxe glaubt, der glaubt,
der Vernunft der Glaube, der jenseits der Vernunft das Paradoxe glaubt, der glaubt, quia absurdum (264), der glaubt, ohne zu sehen (Joh 20,29). In einem solchen Glauben aber sind Zweifel und Verzweiflung, die durch die Erfahrung tragischen Geschicks entstanden, aufgehoben. Zwar bleiben die tragischen Phänomene, Schuld (101) und Leid des Unschuldigen, bestehen (vgl. o. S. 85), die Wirklichkeit ändert sich nicht; doch da auch die Verheißungen Gottes geglaubt werden, durch die Gott sich als der Gütige und Gerechte offenbart, sind trotz des Wissens, dass Gott als der Urheber von allem auch Urheber der tragischen Schuld und des tragischen Leids ist, Zweifel und Verzweiflung aufgehoben. Der Glaube überwindet die Bruchstelle zwischen der von Gott bewirkten Wirklichkeit dieser Welt und den Verheißungen Gottes; und das tragische Leid, das dem Zweifelnden höchst ungerecht erscheint, wird für den Glaubenden zum Mysterium: Wenn der Mensch im Glauben bedingungslos Gott vertraut und auf jedes Begreifenwollen verzichtet, vergeht ihm das Bewusstsein, dass Gott untreu gewesen sei und den unschuldigen Menschen in Schuld und Leid geworfen habe. Der „Empörungsschrei (ist) durch eine besinnungslose Zustimmung ersetzt"(265); besinnungslos, da „weder von der menschlichen Vernunft noch von der Beobachtung der widerspruchsvollen Wirklichkeit her sich die Vertrauenswürdigkeit Gottes begründen lässt"(266). In der christlichen Frömmigkeit heißt diese Zustimmung ‚Ergebung in den unerforschlichen Ratschluss Gottes’ (267).
In dieser Ergebung, in der der Mensch trotz schlimmster Erfahrungen mit Gott auf Gottes Verheißungen hofft, zeigt sich das Gott-Mensch-Verhältnis in seiner eigentlichen Gestalt: Der Mensch hat seine Eigenständigkeit völlig aufgegeben; seine Überwindung des Tragischen durch den Glauben ist ein Sieg durch den Untergang hindurch: der Mensch geht vollkommen auf in der Allmacht Gottes; er ist zwar im Glauben absolut frei (Röm 8,15), er steht über der leidvollen Welt, doch nur, weil er sich bedingungslos an Gott gebunden hat: Sklave Gottes (Röm 6,16-22). Der Mensch anerkennt Gott ohne jede Einschränkung, so dass Gott in seinen Augen an nichts mehr gebunden ist, auch nicht an die Vernünftigkeit, an die Ideen von Gerechtigkeit und Güte. Dieser Gott ist absolut frei, ein Gott der Willkür(268).
Hier nun wird es auch möglich, Wolfram geistesgeschichtlich einzuordnen: Der Glaube an den absolut freien, aber auch gütigen Gott ist eine Leistung, die nicht von Dauer sein kann. Es kann auch Angst die Menschen ergreifen, dieser Gott, den sie nicht mehr begreifen können, sei ein böser, ein despotischer Gott. Eben aus diesem Grund hat die Scholastik immer wieder versucht, Gott als das summum bonum begreiflich zu machen, d. h. aber, dass sie Gott an die Denkgesetze (die sogenannten ‚ewigen Wahrheiten’) des Menschen binden musste. Die Gegenposition - und in ihrer Nähe muss Wolfram stehen, wenn er tragische Konflikte und Gott in Einklang bringen will - sagt von den ewigen Wahrheiten, dass nicht Gott an sie gebunden sei, sondern dass sie umgekehrt von Gott abhängig seien, dass sie „ihre Sanction . . . von dem göttlichen Willen"(269) hätten, dass sie „bloß durch göttliches Gefallen festgestellt"(269), also „zufällige Wahrheiten"(269) seien, „die ebenso gut auch Nichtwahrheiten seyn könnten"(269). Die Wesensbegriffe, die die Menschen den Dingen zulegten, seien also bloße Namen (102) (Nominalismus), nicht aber notwendige Wahrheiten, seien „nur wahr . . . wo und so lange es Gott gefällt"(270). Da Gott also jenseits aller vernünftigen Gesetzlichkeiten stehe, könne er nicht mit der Vernunft, sondern nur im Glauben begriffen werden. Diese Auffassung setzte sich im Mittelalter schließlich durch, da der Versuch der Scholastik, Glaube und Wissen miteinander zu vereinen, scheiterte, und wurde in einer Gegenreaktion zu Beginn der Neuzeit abgelöst durch die ausschließliche Betonung der Vernunft. Gott aber wurde an diese Vernunft gebunden, wurde zur „ewigen Vernunft"(271), der die menschliche Vernunft folgen konnte.
Hiobs und Parzivals Glaube
Die Theologie, die Gott als das Unbegreifliche schlechthin auffasst, liegt auch dem Buch ‚Hiob’ zugrunde. Hiob streitet zunächst gegen den Gott, der gefürchtet werden muss, weil er sich nicht an das vernünftig Gesetzte hält, weil er unberechenbar ist und weil seine Macht nicht durch das Recht begrenzt ist. Es ist der Gott, der Berge umstürzt in seinem Zorn (9,5), der zur Sonne spricht, damit sie nicht strahlt (9,7), der unergründlich Großes schafft (9,10), der aber auch wegrafft, was er will, ohne dass ihn jemand hindern könnte (9,12), der tut, was ihn gelüstet (23,13). Und Hiobs Reaktion ist Furcht und Zittern.
Et idcirco a facie ejus turbatus sum,
et considerans eum, timore sollicitor.
Deus mollivit cor meum,
et Omnipotens conturbavit me (23,15/16). (271)
Die Erlösung von Furcht und Zittern aber geschieht nicht in der Weise, dass Gott an die Vernunft gebunden wird, sondern sie geschieht durch den Glauben, und zwar durch den Glauben an das Paradox, dass Gott dennoch seine Verheißungen erfüllt(272). Dem Glaubenden wird der böse, unheimliche zum rätselhaften, geheimnisvollen Gott, und an die Stelle der Furcht tritt
Ehrfurcht (273).
Es ist Elihu, der die Lösung vorbereitet, indem er mit Nachdruck auf die Rätselhaftigkeit Gottes hinweist: Der Mensch kann über Gott nichts wissen, die wahre Weisheit ist allein Gott vorbehalten (28,12-17; 38,4-40). Da menschliches Begreifen nicht an den unerforschlichen(274) Gott heranreiche, könne der Mensch nicht mit ihm rechten, Gott stehe über den menschlichen Vorstellungen von Gut und Recht(275), und dennoch erfülle er sie - in rätselhafter Weise; Gottes Gerechtigkeit wird also nicht aufgegeben (276).
So also hört Hiob auf, mit Gott zu rechten, und glaubt blind an die Güte dieses Gottes, hofft, ohne einen Grund für seine Hoffnung erkennen zu können.(103)
Und auch Parzival geht diesen Weg. Zunächst lebte Parzival - wie Hiob - im Glück, und sein Vertrauen in Gott war nicht erschüttert. Dann trifft ihn das Geschick und vernichtet ihn, und wie Hiob steht er in jener doppelten Bewegung zu Gott: von ihm weg und zu ihm hin. Als Zweifelnder sagt er sich von Gott los und verzweifelt, zugleich aber drängt es ihn hin zu Gott als dem einzigen, der helfen kann (z. B. 559,18). Schließlich gibt er seinen Kampf gegen Gott auf und übergibt sich ihm ohne Vorbehalt; er hofft auf ihn, obwohl es für ihn nichts zu hoffen gibt, obwohl seine Hoffnung sinnlos ist.
Sinnlos ist seine Hoffnung, da er, auch als er wieder zu Gott gefunden hat, nicht von seinem Leid, seiner Trauer erlöst ist:
ich pin trûrens unerlôst (733,16).
Er hat von Cundrie und Sigune erfahren, dass er für immer verflucht und verdammt ist, dass keines Menschen Bemühen ihn aus diesem Leid erlösen kann:
kein arzet mag iuch des ernern (316,15).(276a)
Nicht einmal durch Reue und Buße wird er Verzeihung erlangen können:
,ir sult wandels sîn erlân,’
sprach diu maget. ‚mirs wol bekant,
ze Munsalvaesche an iu verswant
êre und rîterlîcher prîs.
iren vindet nu decheinen wîs
decheine geinrede an mir’ (255,24-29).(276b)
Versöhnung und Friede werden ihm nie mehr zuteil:
het ich suone oder vride,
diu waern iu beidiu tiure (315,22/23).(276c)
Er sieht kein Ende seines Leids, er hat keine Hoffnung, je den Gral und Condwiramurs wiederzufinden. Und er resigniert vollkommen:
ich enruoche nu waz mir geschiht.
got wil mîner freude niht (733,7/8); (276d)
ich wil ûz disen freuden varn (733,20).
Dieses vorbehaltlose Sich-abfinden mit der leidvollen Wirklichkeit seines Lebens steht nun in einem paradoxen Gegensatz zu Parzivals Erwartungen: Parzival weiß sich ohne zurechenbare Schuld, immer wieder betont er seine tumpheit (269,24 f.; 475,5 f.; 488,15). Auch glaubt er nun, nachdem Trevrizent noch einmal die Lehre der Mutter in Erinnerung gerufen hat, mit absoluter Sicherheit, dass Gott als die triuwe (462,19) und minne sich an seine Verheißungen hält und dem Menschen immer beisteht (vgl. o. S. 47 f.): (104)
sîn helfe ist immer unverzagt (462,10; vgl. 461,28-30; 462,
und wenket sîner minne nieht. 20,26);
swem er minne erzeigen sol,
dem wirt mit sîner minne wol (466,4-6),
denn Parzival antwortet auf Trevrizents Worte:
hêrre, ich bin des immer frô,
daz ir mich von dem bescheiden hat,
der nihtes ungelônet lât,
der missewende noch der tugent (467,12-15).
Außerdem weiß Parzival, dass er den Kampf seines Lebens redlich gekämpft hat und darum mit Recht Lohn erwarten darf:
ist got an strîte wîse,
der sol mich dar benennen,
daz si mich dâ bekennen:
min hant dâ strîtes niht verbirt (472,8-11; vgl. 451,13-22).(276e)
Er hofft also, dass die Zeit seines Heiles kommen (vgl. 783,15), dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Zugleich aber findet er sich im Leid, sieht sich von diesem seine Wirklichkeit bewirkenden Gott in Leid gestürzt und glaubt sich für immer von diesem Gott verlassen. So wird ihm das Tun und das Wesen Gottes unbegreiflich. Gottes Taten sind ihm ein verholnbaerez wunder (700,20) (277; 277a).
(277b)
Er vertraut nun Gott, er vertraut darauf, dass dieser Gott gerecht und gütig ist, dass er die Unschuld nicht leiden lassen wird und dass er des Ritters zuht, manheit und triuwe nicht sinnlos, nicht umsonst sein lässt, sondern wirksam zur Gestaltung eines guten, ehrenvollen Lebens; er vertraut darauf, obwohl er selber leidet, er vertraut also, ohne zu begreifen. In diesem Vertrauen löst sich ihm der Widerspruch zwischen berechtigter Erwartung und erfahrener Wirklichkeit.
Der Glaube ist vollendet, wenn Gott dem Menschen erscheint und der Mensch nicht mehr zu glauben braucht, sondern schauen kann (Hiob 42,5).
Das tragische Leid wird dann nicht mehr im Glauben hingenommen; es ist (105) in der Epiphanie der Herrlichkeit Gottes aufgehoben(278): das Leid der Menschheit bei der Wiederkunft Christi, das Leid Hiobs, als Gott, ihm antwortend, seine Majestät offenbart, das Leid Parzivals, als Gott ihm in der
saelde des Grals erscheint.
Gnade als Voraussetzung für den Glauben
Diese Offenbarung Gottes, durch die der Glaube seine Erfüllung findet, kann vom Menschen nicht erzwungen, verdient werden - das Verdienst des Menschen würde eine Einschränkung der Macht und Freiheit Gottes bedeuten -, sie ist ins freie Ermessen Gottes gestellt; darum sagt Cundrie, die Verkünderin dieser Offenbarung:
got wil genâde an dir nu tuon (781,4).
Und ebenso ist auch jener Glaube, der das Paradoxe glaubt, nicht Verdienst des Menschen, sondern allein Geschenk der Gnade, die jedem zuteilt, wie sie will (l. Kor 12,11). Denn nicht nur dem Schauen (2. Kor 5,7), auch dem Glauben geht die Selbstoffenbarung Gottes voraus, nur offenbart sich hier Gott in seiner Rätselhaftigkeit (Videmus nunc per speculum in aenigmate), während er sich dort in seiner Klarheit offenbart (tunc autem facie ad faciem; 1. Kor 13,12). Auch dies, dass dem Glauben das Sich-Mitteilen Gottes vorangeht, sagt Wolfram deutlich genug: Ganz selbstverständlich stellt er die Gnade an den Beginn der Rückkehr Parzivals zum Glauben:
sin wolte got dô ruochen (435,12).(278a)
Nicht in der Auseinandersetzung zwischen Parzival und Trevrizent liegt der Wendepunkt auf dem Weg des Helden, der Wendepunkt liegt vor diesem Gespräch; nicht Parzival selbst und sicherlich nicht Trevrizent bewirken also die Zuwendung Parzivals zu Gott, sondern Gott selbst. Das Geschehen ist ausschließlich bestimmt durch den Willen und Ratschluss Gottes (vgl. o. S. 15; vgl. Hiob 38,2; 42,3: sententiae, consilium).
Das Verhältnis von Gnade und Verdienst
Diese Vorstellung, dass Gott a l l e s bewirkt, auch jedes Tun des Menschen, und dass der Mensch von sich aus nichts vermag, hat Augustinus in der Auseinandersetzung mit Pelagius extrem ausgeformt. Die Kirche ist dieser Vorstellung nicht ohne Einschränkung gefolgt, da sie dem Menschen die Eigenständigkeit im Bösen wie im Guten und damit auch seine Verantwortlichkeit für seine Verfehlungen nicht absprechen wollte. So versuchte sie eine Annäherung der beiden theologischen Standpunkte: Zwar sei Gottes Wille allwirkend, doch der Mensch auch frei in seinen Entscheidungen (liberum arbitrium) und fähig, von sich aus das Gute zu tun; und darum seien seine guten Taten nicht nur Gottes Gnade, sondern auch des Menschen Verdienst.
(106) Diese Gnadenlehre ist auch für die Interpretation des ‚Parzival’ herangezogen worden, so von M. Gerhard, die über Parzivals Weg zum Gral schreibt, dass „kein Suchen und Wollen die Weihe erzwingen kann und dass doch eben das Suchen, das Wollen zu ihr hinführt"(279). Wie dieses Zusammenwirken von Gnade und Verdienst möglich sei, bleibe „unergründliches göttliches Geheimnis. Aber dass dies Wunder wirklich geschah"(280), so meint Schwietering, sei „Gewissheit innerer Erfahrung"(280).
Zunächst spricht einiges dafür, dass Wolfram tatsächlich eine Synthese von menschlichem Verdienst und göttlicher Gnade im Sinne gehabt haben könnte. Zwar ist für ihn die Erringung des Grals Werk der göttlichen Gnade (781,4; 783,10; 795,21), doch heißt es auch von Parzivals Weg zum Gral, dass Parzival um den Gral gerungen (732,19), den Gral erstriten(281), sogar bejagt (282) und erzürnet (798,3) habe; Gott sei Parzivals Willen werhaft geworden (798,5) und Parzival sei in unverzaget mannes muot (1,5) mit dem swerte dem Gral genaht (503,27-30): schildes ambet umben grâl (333,27). Der Mensch brauche also nicht „passiv auf die göttliche Gnade (zu) warten„, sondern könne aktiv darum ringen"(283); das sei Wolframs Meinung, sagt Maurer. „Rechtes ritterliches Streben und Gottes Gnade wirken zusammen, ja, der unverzagete mannes rnuot trotzt nun beinahe doch noch Gott das Gnadenwunder der Berufung zum Gral ab"(284), so fasst Maurer seine These über das Zusammenwirken von Gnade und Verdienst zusammen. Das ‚beinahe’ bestimmt er noch etwas genauer: „Die Berufung durch Gottes Gnade„ bleibe „das Wesentliche"(284).
G. Weber und mit ihm andere wollen sogar eine theologiegeschichtliche Entwicklung im Roman feststellen, die Entwicklung von einem Augustinismus, der der Gnade alles, dem menschlichen Verdienst nichts zuerkenne, hin zum Thomismus, der dem selbständigen Verdienst des Menschen größere Möglichkeiten einräume(285): „Das Entscheidende . . . ist . . . das eigene menschliche Wollen."(286)
Die Gralsprämissen
Erörterungen solcher Art gehen von den sogenannten Gralsprämissen aus, deren erste bestimmt, dass man nur ‚zufällig’ die Gralsburg finden könne:
swer die suochet flîzeclîche,
leider der envint ir niht.
vil liute manz doch werben siht. (286a)
ez muoz unwizzende geschehen,
swer immer sol die burc gesehen (250,26-30).
,Zufällig’ heißt aber für den Christen: geführt durch den gnädigen Willen Gottes (vgl. o. S. 25), dem sich Parzival z. B. überlässt, als er seinem Pferd die Zügel gibt
(nâch . . . gotes kür; vgl. Anm. 242). Der Prämisse (107) des unwizzende geschehen liegt also die Vorstellung zugrunde, dass der Mensch nichts tun kann ohne Gott, dass sein vlîz keinen Einfluss auf die Gnade hat (287), dass Gott in absoluter Freiheit gibt und nimmt, ohne sich vom Tun des Menschen bedingen zu lassen, dass Gott also willkürlich mit dem Menschen umgeht, den einen beruft, in seine Nähe ruft, den anderen, wenn er ihm zu nahe kommt, tötet; Liddamus rechnet damit, und er glaubt, dass man Gawan, wenn man ihn zur Gralssuche verpflichte, dem sicheren Tod entgegenschicke (426,2-5; vgl. 473,5-11). Und der Heide, der glaubt, aus eigener Kraft den Gral erringen zu können (der selbe heiden was gewis, /sîn ellen solde den grâl behaben; 479,18/19), wird von Anfortas getötet.
Wenn aber Parzival ohne sein Wissen, ‚zufällig’, den Gral findet bzw. den Gralskönig, der ihn zum Gral weist, und wenn er den Gral erreicht, ohne getötet zu werden, so zeigt dies, dass er auch der zweiten Prämisse genügt, die dasselbe sagt wie die erste: dass der, der zum Gral kommt, von Gott benant sein muss (288) (288a), d. h. dass der Mensch nicht durch seine Werke die Gnade verdienen, auch nicht mit der Gnade mitwirken kann, sondern dass die Gnade ihn unabhängig von seinem Tun beruft (vgl. Röm 8,12).
Nun kommt aber Parzival später als W i s s e n d e r zum Gral; und dies war einigen Interpreten Beweis genug für die These, die theologische Grundhaltung habe sich im Roman gewandelt, die Prämisse sei geändert und zeige in ihrer neuen Form „die größere Verselbständigung des menschlichen Willens, der die Gnadengabe des Grals, die sonst dem Berufenen u n w i z z e n d e zuteil wird, bewusst erstreitet und göttlichem Willen abtrotzt . . ."(289)(289a. Dagegen aber spricht eine weitere Prämisse - und sie ist das letzte, was über das Verhältnis des Menschen zum Gral gesagt wird:
kein strît möht in erwerben (786,9).
Gemeint ist: der Mensch vermag nichts ohne oder sogar gegen Gott; Gottes gnädiger Wille ist absolut. Der Mensch kann also göttlichem Willen nichts abtrotzen, und darum muss die Tatsache, dass Parzival beim zweiten Mal wissend zur Gralsburg kommt, anders gedeutet werden: Die Prämisse, dass man nur unwizzende zur Gralsburg komme, hat sich bei Parzival erfüllt, und Wolfram hat gezeigt, was er mit dieser Prämisse zeigen wollte: dass Parzival zum Gralsrittertum berufen ist. Nun braucht aber Parzival nicht jedesmal, wenn er wieder zur Gralsburg kommt, zuvor vergessen, dass es diese Burg gibt; auch die übrigen Berufenen ziehen aus in die Welt und kommen zur Gralsburg zurück, ohne dass sie zunächst vergessen müssen, wozu sie berufen sind. Dass also der, der zum ersten Mal - unwizzend, und also von Gott benant - zur Gralsburg kommt, nun auch ohne diese Bedingung immer wieder zu ihr zurückfindet, ist selbstverständlich; und darum erwarten die Gralsritter ja auch Parzivals Rückkehr (788,13-20).(108)
Sigunes Bedingung, dass man nur unwizzende die Gralsburg findet, gilt also nur für das erste Finden und demnach ebenso die mit dem unwizzende geschehen verknüpfte Bedingung, dass der die Burg nicht findet, der sie flîzeclîche suochet. Wer sie gefunden hat - unwizzende und ohne eigenes Bemühen -, der ist berufen und wird sie immer wieder finden, auch wenn er nun, angerührt von dem ihm bestimmten, zum ersten Mal in greifbare Nähe gerückten, aber noch nicht völlig begriffenen Ziel, um dieses Ziel ringt, es bejagt, schildes ambet um es trägt. Der Mensch kann die Berufung nicht herbeiführen; doch wenn er berufen ist, wird seine Sehnsucht ihn antreiben, das Ziel, zu dem er berufen ist, zu erreichen.
Es gibt also im ganzen Roman keine Einschränkung der entscheidenden Prämisse, die zum ersten Mal von Trevrizent genannt wird:
jane mac den grâl nieman bejagn,
wan der ze himel ist sô bekant
daz er zem grâle si benant (468,12-14)
und die Parzival bestätigt und endgültig klärt, indem er fast wörtlich Trevrizents Gedanken wiederholt:
daz den grâl zu keinen zîten
niemen möht erstrîten,
wan der von gote ist dar benant (786,5-7).
Und damit das Wort nicht missverstanden wird, fügt Parzival noch hinzu:
kein strît möht in erwerben (786,9).
Als gewichtigste Einschränkung der Prämisse, dass kein strît den Gral erwerben kann, dass menschliches Tun nichts vermag, erschienen der Forschung die Verse, in denen Trevrizent seine Meinung über das Verhältnis von Verdienst und Gnade ändert. Trevrizent hatte zunächst gesagt, dass niemand den Gral bejagn kann, außer er sei von Gott berufen. Am Ende des Romans aber glaubt er, Parzival habe den Gral erzürnet (798,3), habe ihn Gott abgetrotzt, habe ihn gewaltsam, eigensinnig, hochmütig erstritten, Gott sei Parzivals willen werhaft worden (798,5). Diese zweite Meinung Trevrizents bezeugt aber nicht notwendig, dass Wolfram seine Ansicht über das Verhältnis von Gnade und menschlichem Vermögen geändert habe; vielmehr kann dieser Handlungszug auch zeigen, dass Trevrizent Parzival und dessen Schuld falsch beurteilt (vgl. o. S. 96). Da Trevrizent bis zuletzt bei seinem falschen Urteil bleibt - Parzival habe sich als Sünder erwiesen, könne also von Gott nicht zu Höchstem berufen, könne nicht von Anfang an
benant (473,12) sein(290) (vgl. o. S. 95) -, muss er dem Menschen die Möglichkeit einräumen, wesentlich Einfluss auf den Willen Gottes zu nehmen. Wenn Parzival entgegen Trevrizents Meinung Gralskönig wird, so sei dies Parzivals eigene Leistung, auf die er, weil eine solche Einwirkung auf die Entscheidungen Gottes ungeheuer sei, maßlos stolz sein könnte. Den Gott, der sich so beeinflussen lasse, versteht Trevrizent nicht mehr (109) (vgl. o.
S. 96); den neuen Gralskönig aber glaubt er vor Hochmut bewahren zu müssen:
nu kêrt an diemuot iwern sin (798,30).
Schon diese Ermahnung zeigt, dass Trevrizents Beurteilung der Ereignisse falsch sein muss, denn Wolfram lässt keinen Zweifel daran, dass Parzival die Demut bereits besitzt, zu der Trevrizent ihn erst bekehren will. Parzival weiß, dass er unschuldig ist an seiner Schuld; er braucht also nicht auszuschließen, dass er von Gott benant ist, er braucht darum auch nicht stolz darauf zu sein, dass er sein Ziel erreicht hat. Denn da in seinen Augen sein Schicksal nicht der Erweis dafür ist, dass er nicht prädestiniert sei, hält er es auch nicht für sein Verdienst, dass er nun endlich, wenn auch auf Umwegen, sein Ziel erreicht hat. Für ihn ist sein Weg, auch der Umweg (vgl. 783,15), ein Teil des Heilsplans Gottes(291).
Dieser Umweg, den Gott ihn gehen ließ, hat ihn zudem erfahren lassen, dass der Mensch von sich aus nichts vermag. Indem er ohne Willen und Wissen in Schuld fiel, wurde er zur Erkenntnis geführt, dass der Mensch in seinem Wesen nichtig und darum ganz von der Gnade Gottes abhängig ist. Darum sieht er es nicht als sein Verdienst an, wenn er Gralskönig wird und Anfortas erlöst, sondern als das Werk der güete Gottes (795,22), die sich nicht gegen die Schwachheit des Menschen, sondern durch, mit, in dessen Schwachheit durchsetzt. Als Cundrie ihn preist:
ôwol dich, Gahmuretes suon!
got wil genâde an dir nu tuon (781,3/4),
antwortet er „nicht einmal: ‚Mit der Hilfe der Gnade habe ich das Ziel erreicht’"(292), sondern, „überwältigt"(292)von der Gnadenbezeugung Gottes:
sô hât got wol zuo mir getân (783,10).
Er denkt also keinen Augenblick an die Mühsal, die er um den Gral erlitten hat, denn er weiß, dass auch die Kraft zu diesem Leid von Gott kam. Für ihn ist also das erstrîten kein erzürnen, sondern selbstverständlich geknüpft an die Voraussetzung: wenn ich Gottes Gnade habe, wenn ich benant bin.
Wenn man bei der Interpretation die Handlungsführung des Romans und die Äußerungen seines Helden, Parzivals, berücksichtigt, nicht aber die Vorstellungen Trevrizents - denn dieser wird ja durch den Verlauf des Romans ins Unrecht gesetzt -, so kann man von Wolframs Vorstellung über das Verhältnis von Verdienst und Gnade sagen, dass Wolfram nicht meint, der Mensch könne Gott etwas abtrotzen oder Gott und Mensch kämen sich beiderseitig entgegen, so dass jeder die Freiheit des anderen beschränke. Vielmehr müssen Wolframs Vorstellungen so interpretiert werden, dass jedes Tun des Menschen, jede menschliche Tauglichkeit aus der Kraft Gottes (vgl. o. S. 41; S. 51) kommt(293), dass nichts geschieht, ohne dass der allmächtige und gnädige Gott es bewirkt hat. (110)
Der Wolframsche Augustinismus in kulturhistorischer Sicht
G. Weber hat innerhalb seiner ‚Parzival’-Interpretation den Untergang der ritterlichen Kultur theologisch zu begründen versucht: Diese Kultur sei untergegangen, weil der Augustinismus, durch den sie bestimmt sei, dem Menschen jegliche „Eigengesetzlichkeitserfahrung"(294) genommen habe; dem Menschen jener Zeit habe jede Eigenständigkeit und damit jede Initiative gefehlt.
Doch ist auch denkbar, dass in einer Blütezeit christlicher Frömmigkeit menschliche Initiative und der Gedanke der Allwirksamkeit Gottes sich nicht ausschließen. Und Wolfram muss als Repräsentant einer solchen Zeit gelten, wenn er den unverzaget mannes muot mit der Vorstellung, dass Gott Anfang und Ende von allem ist, vereinen konnte. So verfällt der Ritter Wolframs, der sich selbstverständlich in der Gnade aufgehoben weiß, nicht der Gefahr eines Quietismus, sondern kämpft unverzagt, weil er weiß, dass sein Tun im Einklang mit dem Willen Gottes steht; und so erliegt er auch nicht dem Gedanken, gegen das Übel, da es von Gott bewirkt sei, nichts tun zu können, denn er weiß, dass in seinem Kampf gegen das Übel sich die Größe Gottes erweisen wird.
Es kann also nicht behauptet werden, der Augustinismus sei notwendig kulturfeindlich. Zwar vermag der Mensch nach dieser Lehre nur etwas, wenn Gott ihm beisteht, und alle Fähigkeiten des Menschen, auch die kulturbildenden, sind nur wirksam, wenn der Mensch erleuchtet ist von der lux aeterna (vgl. o. S. 13 f.), wenn er belehrt ist von dem ‚Einen, der euer Lehrer ist’(295). Dabei muss vorausgesetzt werden, dass der Mensch sich diesem Licht nicht verschließt, dass er die richtige Richtung des Willens hat. Doch auch diese Hinwendung des Willens auf die Gnade ist selbst wieder Werk der Gnade Gottes
(296). Der Mensch, der sich in dieser Weise begnadet wusste, konnte mit seiner ganzen Kraft sein Eigensein entfalten und Kultur schaffen.
Der Ritter der höfischen Gesellschaft, so wie Wolfram sie sah, war ein solcher Mensch. Für Wolfram sind also der Ritter und sein ganzes Tun, auch seine weltliche Freude, nicht ein Gegenpol zur Gnade, sondern Folge der Gnade. Darum ist es nicht sinnvoll, zu formulieren, Parzival erreiche sein Heil, „auch wenn er als Ritter kämpft, k e i n e s f a l l s aber, w e i l er als Ritter kämpft"(297). Um diese Unterscheidung geht es nicht, und man formuliert besser: Er erreicht sein Heil, indem er als Ritter kämpft.
‚zwîvel’ als Folge des Entzugs der Gnade Gottes
(Interpretation des Prologs)
Die Gnade wurde oben (S. 105) als Voraussetzung für den Glauben erkannt, da der Glaube an den Deus absconditus menschliches Begreifen übersteigt und darum nicht als eigenständige Leistung des Menschen verstanden werden (111) kann. Dem Glauben geht also die Gnade voraus. Der Zweifel an Gott und die Verzweiflung stellen sich demnach ein, wenn Gott dem Menschen seine Gnade entzogen hat. Für den zwîvel gilt also, was für jede Verfehlung des Menschen gilt: er ist dem Menschen nicht als Schuld zurechenbar, da der Zweifelnde und Verzweifelnde nicht mit Willen seinen Glauben verloren hat. Auch der Verlust des Glaubens ist ein Geschick, an dem der Mensch unschuldig ist.
Wenn man in dieser Weise Wolframs Vorstellung von der Schuld des Menschen auch auf den zwîvel überträgt, so versteht man, wie Wolfram zu der für seine Zeit ungewöhnlichen Beurteilung des zwîvels gekommen ist.
Hartmann hat im ‚Gregorius’ die in jener Zeit allgemein verbreitete(298) Beurteilung des zwîvels formuliert: Er begreift den zwîvel als Misstrauen gegenüber Gott und darum als Gotteslästerung(299) und rechnet ihn deshalb dem Menschen als Todsünde zu, durch die der Mensch sich unwiderruflich dem ewigen Tod anheimgegeben habe(300). Wolfram dagegen weiß zwar, wie bitter der zwîvel für den Menschen ist, und er weiß auch, dass der, der sich für immer der Verzweiflung überlässt, von Gott, dem Licht der Erkenntnis, völlig verlassen sein muss; doch ist ihm der zwîvel nicht ein strafbares Vergehen des Menschen, das nie vergeben wird: der Mensch ist zeitweilig mit Blindheit geschlagen, und der ihn geschlagen hat, führt ihn auch durch das Dunkel wieder hin zum Licht, und er gibt ihm Kraft, auch in der Verzweiflung dennoch auszuharren und sich bereitzuhalten für einen alles lösenden Erweis der Gnade: der mich zwîvels hât erlôst (Wh 1,24).
Es muss an dieser Stelle kurz über die Bedingung der Möglichkeit gesprochen werden, dass einer Dichtung Vorstellungen zugrunde liegen, die zu der Zeit, als die Dichtung entstand, keine allgemeine Gültigkeit hatten und nicht von der entsprechenden Wissenschaft, hier der Theologie und Philosophie, deutlich formuliert waren. Es muss weiterhin über die Schwierigkeiten gesprochen werden, die sich durch die Diskrepanz von Dichtung und wissenschaftlicher Begrifflichkeit ergeben.
Es wird gesagt: Dichtung habe einen Vorrang vor anderen Aussagen, sie entspreche der Wirklichkeit eher und sei darum wahrer als die Aussage in wissenschaftlicher Begrifflichkeit, weil sie die allgemeine Wahrheit, die sie mitteile, in einem besonderen Fall darstelle. Sie bleibe so der Wirklichkeit näher als die abstrakten Verallgemeinerungen wissenschaftlicher Reflexion. Die Begriffe der Wissenschaft müssen eindeutig sein, wenn sie ihren Sinn, eine handhabbare Übersicht zu verschaffen, erfüllen sollen. Diese eindeutigen Begriffe haben zwei Nachteile, die der Dichtung ihren Vorrang sichern: sie entsprechen oft nicht der komplexeren Wirklichkeit, und sie haben ein starkes Beharrungsvermögen, da ihr richtiger Gebrauch und entsprechend die Abweichungen leicht nachprüfbar sind. So kann es geschehen, dass die Dichtung auf Wirklichkeitserfahrungen hinweist, die von den entsprechenden Wissenschaften nicht bzw. noch nicht gefasst werden.(112)
Wenn nun der Dichter selbst sich der Vorstellungen der Wissenschaft bedient, um seine Dichtung zu deuten, so wird zwischen Dichtung und Deutung, zwischen dem, was der Dichter meint, und dem, was zu sagen ihm die deutenden Begriffe erlauben, keine genaue Übereinstimmung bestehen.
Dass Wolframs Gottes- und Menschenbild nicht den allgemeinen Vorstellungen entspricht, die seine Zeit vom Menschen und von Gott hatte, ist dargelegt worden. Wolfram folgt nicht der Tendenz der mittelalterlichen Theologie, Probleme, die im Alten Testament (z. B. Hiob) und im Neuen Testament (z. B. Paulus) in aller Schärfe aufgezeigt waren, zu entschärfen(301). Da aber Wolfram im Prolog das Gottes- und Menschenbild, das er durch den Handlungsverlauf des Romans anschaulich macht, zu deuten versucht, bei dieser Deutung aber auf die seiner Zeit zur Verfügung stehenden Begriffe und Metaphern angewiesen ist, wird in diesem Prolog der Unterschied deutlich zwischen den Vorstellungen Wolframs und jenen, die den theologischen Begriffen zugrunde liegen.
Es soll die Aufgabe des Prologs sein, den Zuhörer auf das folgende Geschehen vorzubereiten, ihn für das Besondere dieses Geschehens aufgeschlossen zu machen. Die Zuhörer Wolframs aber waren Ritter, nicht Theologen; und selbst wenn Wolframs theologische Kenntnisse über laienhaftes Wissen hinausgegangen wären, so dass er sich als Theologe mit den theologischen Vorstellungen seiner Zeit hätte auseinandersetzen können
(302), so war er doch, wollte er sich bei seinem Publikum verständlich machen, an die konventionelle Begrifflichkeit gebunden, an die das Publikum durch die Predigt gewöhnt war, gebunden also an ein sprachliches Instrumentarium, das zur Darlegung dessen, was er meinte, nicht recht geeignet war.
So muss ihm die konventionelle Einteilung in Gute und Böse, Errettete und Verdammte (vgl. Gleichnis von den Böcken und Schafen) Schwierigkeiten bereiten, vor allem bei der Betrachtung des des zwîvels, den er durch die betonte Erwähnung im ersten Vers als ein Hauptthema des Romans (303) ankündigt; denn er rechnet ja nicht, wie Hartmann es tut, den Zweifelnden und Verzweifelnden den Verdammten zu, sondern zählt ihn sogar zu den von Gott Erwählten.
Keferstein vermeidet diese Interpretationsschwierigkeit, indem er den zwîvel des ersten Verses nicht als religiösen Zweifel auffasst. Er deutet ihn als moralische Unsicherheit („Unsicherheit über den rechten Weg"(304)); da aber Parzival alle ethischen Entscheidungen (auch die auf der Gralsburg), wenn schon nicht immer richtig, so doch ohne jedes Zögern fällt, gibt es für eine solche Interpretation im Roman keine Belege, und also muss unter diesem zwîvel das Nächstliegende verstanden werden: ein Irrewerden am Wesen Gottes, an seiner triuwe, ein Verlust des Glaubens(305), der auch das dem Verstand Verborgene, ja ihm Widersprechende glaubt. Das nhd. Wort (113) ,Zweifel’ entspricht dieser mhd. Bedeutung; doch muss bedacht werden, dass zwîvel auch die Wirkung des Zweifels: Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung (vgl. o. S. 86) umgreift. In den Versen
Ist zwîvel herzen nâchgebûr,(305a)
daz muoz der sêle werden sûr (1,1/2)
(,Ein Herz, das vom Zweifel überfallen wird,
muss bitteres Leid erfahren’)
ist diese umfassende Bedeutung im Hauptsatz vorausgesetzt, denn sûr bezeichnet das bittere Leid des Verzweifelten, nicht aber, wie einige Interpreten glauben (vgl. Martin zur Stelle), die Höllenqual(306), da Wolfram - anders als Hartmann - den zwîvel nicht als die Sünde wider den Heiligen Geist ansieht(307) (vgl. 0. S. 111), Parzival also selig wird, obwohl er durch Zweifel und Verzweiflung rehte enmitten durch (140,17) gegangen ist.
Weil aber der Zweifelnde nicht unbedingt der Hölle überantwortet ist, kann man ihn nicht dem swarz des Prologs zuordnen. Am Zweifelnden hat beides teil: Hölle u n d Himmel; er ist wie die Elster schwarz und weiß, gesmaehet und gezieret zugleich (vgl. o. S. 37):
gesmaehet unde gezieret
ist, swâ sich parrieret
unverzaget mannes muot,
als agelstern varwe tuot (1,3-6). (307a)
Schwarz bedeutet die Finsternis der Gottverlassenheit: die Hölle. Weiß bedeutet das Licht, das Gott als das Gute, das Wahre und das ewige Leben ist (vgl. o. S. 45): den Himmel.
Sofern Gott in der Welt wirkend ständig gegenwärtig ist, sofern das von Gott in den Menschen gepflanzte unzerstörbare Gute (vgl. o. S. 34), das göttliche Teil im Menschen wirksam ist, hat der himel teil an diesem Menschen: des Menschen mannes muot ist unverzaget, tapfer und beharrlich(308) folgt der Mensch dem guten art, der von Gott in ihn hineingelegt ist (nos fecisti ad te), sein Wille(309) ist fest auf das ihm von Gott bestimmte Ziel gerichtet: Dieses Immer-strebend-sich-bemühen, auch während des Irrens, macht die staete des Menschen aus, so dass unverzaget mannes muot der weißen Farbe und der staete zuzuordnen ist.
Der unverzaget mannes muot aber parrieret sich, als agelstern varwe tuot. Die Farbe der Elster ist aus zwei Gegensätzen, Schwarz und Weiß, gemischt. Dieses Beisammen des Gegensätzlichen im Elsterngefieder ist das Ergebnis des Sich-parrierens, so dass der Vergleich sehr zusammengerafft gefügt ist. Beachtet man, dass sich parrieren nicht ‚in sich gegensätzlich sein’ bedeutet, sondern: ‚mit seinem Gegenteil verbunden sein’(310), so meinen (114) die drei Verse 1,4-6, in ihre einzelnen logischen Glieder zerlegt: der in jedem Fall positiv (= blanc) zu wertende unverzaget mannes muot parrieret sich, hat sein Gegenteil bei sich, so wie die weiße Farbe des Elsterngefieders mit ihrem Gegenteil (swarz) vermischt ist. Das Gegenteil vom unverzaget mannes muot aber kann, da sonst nichts ausdrücklich genannt wird, nur das verzagen sein: der muot, der an Gott(311)und der Welt zweifelt und verzweifelt(312). Diese Deutung, dass das verzagen, der zwîvel das zu ergänzende Gegenteil zum unverzaget mannes muot sei, liegt schon darum nahe, weil das Publikum bis zu Vers 5 des Prologs nur einen einzigen Begriff gehört hat, der zur Ergänzung geeignet ist: den zwîvel, und weil es diesen Begriff wegen seiner prägnanten Betonung noch gut im Ohr hat. Dem
zwîvel als dem Gegensatz zum unverzaget mannes muot muss also die schwarze Farbe und die unstaete zugeordnet werden. unstaete im Verhältnis zu Gott ist die Folge des zwîvels, da der Verzweifelnde, von Gott als dem wahren Erkenntnisgrund verlassen, mit Blindheit (tumpheit) geschlagen (traeclîche wîs; vgl. o. S. 67), von Gott abfällt und in der Gottesferne, im Irrtum lebt: die Hölle hat so teil an ihm.
Doch es geht Wolfram nicht um den zwîvel, sondern um den Zweifelnden und Verzweifelnden. Der aber ist immer auch zugleich auf Gott hin gerichtet, auch in der Zeit seines Irrens von Gott als seinem Ziel geleitet, also nie ganz von ihm verlassen, so dass sich für den Zweifelnden die paradoxe Formulierung ergibt:
der mac dennoch wesen geil:
wand an im sint beidiu teil,
des himels und der helle (1,7-9).
Wer strebend sich bemüht (unverzaget mannes muot), wird schließlich erlöst (geil), so dass Irrtum und Abweg immer nur zeitweilig sind und gerade auch im Irrtum und Abweg die Stärke des unverzaget mannes muot (313)sich beweist(314): Parzival ist zwar traeclîche wîs, aber immer küene (4,18), tump, aber wert (126,19).
Wer dagegen nicht nur zeitweilig in die Irre, sondern ständig in die falsche Richtung geht, ständig in Gottverlassenheit, Gottesferne, in der Finsternis lebt (l. Joh 1,6 f.; vgl. o. S. 45), den nennt Wolfram der unstaete geselle (nach 119,26 auch der untriuwe): er ist für immer mit der unstaete verbündet, hat nie staete gedanken. Es fehlt diesem gesellen der unstaete der unverzaget mannes muot, der vom rechten Ziel nie ablässt; denn sein art ist nicht auf Gott hin angelegt. Darum strebt er nicht ständig zu Gott hin wie der unverzaget mannes muot, der selbst auf Abwegen noch auf ihn bezogen bleibt, sondern immer nur von Gott fort: er ist staete an bösen dingen (315); das triuwe-Verhältnis zwischen ihm und Gott ist für immer zerstört: „unstaete bedeutet die Verewigung der Zerrissenheit"(316). Bei diesem (115) Menschen sind Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung endgültig, er ist für die Hölle prädestiniert:
der unstaete geselle
hât die swarzen varwe gar,
und wirt och nâch der vinster var (1,10-12).
Hier nun liegt ein solcher Fall vor, dass Wolfram, an die Terminologie seiner Zeit gebunden, seine Weltsicht nicht präzise genug formulieren kann (vgl.o. S. 111 f.) (317): Einen Gesellen der unstaete, einen Menschen, dessen Verhältnis zu Gott für ewig zerrissen ist, kann Wolfram sich nicht vorstellen, da das Verhältnis zwischen Gott und Mensch für ihn letztlich vom allmächtigen Gott allein bestimmt ist, Gott also einen solchen Menschen von Anfang an der Hölle zugedacht hätte (318). Eine solche Tat Gottes aber widerspräche seiner Güte. Der Fall dessen, der die swarzen varwe gar hat, wird zwar erwähnt, weil die Theologie seiner Zeit ihn nicht ausschließt, bleibt aber für Wolfram hypothetisch. Dem Roman als Ganzem liegt die eigenwillige Auslegung der Prädestinationslehre zugrunde, dass zwar alles vorherbestimmt ist, niemand aber für die Hölle; ein Mensch, der die swarzen varwe gar hat, wird im Roman nicht gezeigt. Im Menschen Wolframscher Prägung behauptet sich trotz vieler Irrwege immer das Gute, so wie es sich in Parzival, obwohl er traeclîche wîs war, behauptet hat:
sô habet sich an die blanken
der mit staeten gedanken (1,13/14).
Dass der Zweifelnde gerechtfertigt wird, muss für eine Zeit, in der das Zweifeln einer Gotteslästerung gleichkam (vgl. o. S. 111), etwas Unerhörtes, kaum Verstehbares gewesen sein, es muss verwirrend gewesen sein wie ein Haken schlagender Hase, nur den wîsen, nicht aber den tumben, unverständigen Leuten erkennbar: sine mugens niht erdenken (1,17). Die tumben können es nicht fassen, denn ihr Denken bleibt an der Oberfläche (antlützes roum (318a); 1,22), so wie das Bild des Spiegels(319) und die Vorstellungen(320) eines Blinden nur die Oberfläche fassen und darum trügerisch sind (trüebe lîhte schîn; 1,24), weil ohne staete (1,23/24), ohne Beständigkeit und Substanz(321). Wer die Menschen nicht in ihrem Wesen erkennt, sondern sich an die Oberfläche hält, der teilt sie ein in Gläubige und Zweifelnde, Selige und Verdammte, Gute und Böse(322), so also, wie sie für den Augenblick ihm erscheinen. Völlig verwirrt ist er dann, wenn sie sich anders zeigen, als er sie aufgrund seines starren Urteils eingeschätzt hat, wenn sie nicht in diese Einteilung nach Gut und Böse passen und einmal so, dann wieder so erscheinen, z. B. schwankend zwischen wîsheit und tumpheit, Glaube und Zweifel. Das Zugleich der Gegensätze in einem Menschen, die schanzen, von denen Wolfram (2,13) spricht,(322a) kann der tumbe nicht fassen, und darum kann er dem Menschen nicht gerecht werden: das Wesen des von ihm oberflächlich Beurteilten entzieht sich ihm durch seine Widersprüchlichkeit wie (116) ein aufgescheuchter Hase, er sieht nur noch das Hin- und Herschwanken, das Hakenschlagen. So wird er sich immer wieder in seinem Urteil getäuscht sehen, ohne zu erkennen, dass er es war, der falsch gesehen hat:
dirre trüebe lîhte schîn:
er machet kurze fröude alwâr (1,24/25).
Wer dagegen nicht beim trügerischen Schein der Dinge bleibt, sondern ihnen auf den Grund geht, wird nicht verwirrt sein, sondern erkennen, dass der Mensch in seinem Wesen gegensätzlich ist, dass in ihm Schuld und Unschuld ineinandergefügt sind(324) (Unschuld parrieret sich mit Schuld); er wird erkennen, dass diese Fügung des Gegensätzlichen, weil aus dem Wesen des Menschen kommend, seiner Herkunft entspringend (vgl. o. S. 13), notwendig ist: ein letztlich von Gott geschicktes Schicksal - also auch das Schwanken zwischen Glaube und Zweifel
(325) -, und dass es darum sinnlos ist, den Menschen zu verurteilen, alle Verwirrung und alles Leid als gerechte Strafe anzusehen und so aufgrund falscher Schlüsse den leidenden Menschen als böswilligen Sünder zu betrachten. Der
tumbe, der ohne diese Erkenntnis oberflächlich urteilt, wird darum das rechte Verhältnis (triuwe) zu seinem Mitmenschen verfehlen: valsch geselleclîcher muot (2,17).
Den Menschen in seinem tiefsten Wesen zu erkennen, in seiner Schicksalhaftigkeit und völligen Abhängigkeit von Gott, ist aber selbst den
wîsen nicht selbstverständlich; sie brauchen Hinweise (lêre; 2,8), die ihnen der Dichter durch die besondere Richtung (stiure; 2,7)(326), die seine maere einschlagen, geben kann. Aus dieser Haltung des Dichters, der sich als Präzeptor der wîsen unter seinen Lesern versteht, spricht das starke Selbstbewusstsein des Ritters und Laien, der zu solchen Einsichten nicht so sehr durch die Beschäftigung mit der Theologie, sondern vor allem durch die eigene Erfahrung der Wirklichkeit gekommen ist(327). Seine Gegner kann Wolfram aufgrund seines Selbstbewusstseins überlegen verspotten: ‚Wer will mich denn da bei den Haaren packen, wo ich gar keine habe: an der Innenseite meiner Hand! Der weiß wohl gefährlich zuzupacken! Schrei ich weh bei solcher Gefahr, so passt das doch sicherlich zu mir!’ (1,26-30)
Dass man tatsächlich heftig versucht hat, Wolfram oder zumindest sein Werk anzugreifen, eben weil er bei seinem Dichten nicht von dogmatischen Lehrsätzen, sondern von der Erfahrung der Wirklichkeit ausging, beweist der Dichter des ‚Jüngeren Titurel’: „Ich habe durch meine Darstellung die Leser in die Irre geführt, wirft man mir vor"(328)(19/20) (329), sagt Albrecht von Scharfenberg in der Maske Wolframs, und besorgt um dogmatische Korrektheit glaubt er, Wolfram verteidigen zu müssen, indem er teils Wolframs Prolog im Sinne der kirchlichen Lehrmeinung erklärt, teils sogar Wolfram einen Widerruf in den Mund legt: „Früher habe ich im Parzival den Zweifel zu sehr erhoben"(328) (18) (329). In derselben Strophe heißt es: „Wer Sünde hat, soll nicht an der Vergebung zweifeln. Der Zweifel an Gottes Gnade ist (117) das schlimmste"(328). Wolframs sûr (1,2) wird dann ganz im Sinne Hartmanns gedeutet: „Ewig muss der Zweifel der Seele schaden"(328) (22) (330). Der Mensch darf zwar Sünder sein, aber nicht zweifeln: „Aber den Zweifel muss der geile meiden, wenn er auch an Himmel und Hölle teil hat"(328) (25) (331). Der Zweifelnde entspricht also dem, der die swarzen varwe gar hat, also für immer von Gott getrennt ist. Diese Deutung aber bedeutet eine Verkehrung dessen, was Wolfram gemeint hat: dass der Mensch, der, von Gott verlassen, das Leid der Welt erfährt und darüber an Gottes Güte verzweifelt, nicht schuldig gesprochen werden kann, da Zweifel und Verzweiflung sich ihm angesichts des Leids des Unschuldigen aufdrängen, und dass der Glaube, der trotz der Erfahrung des Leids an der Güte Gottes festhält, der das Unbegreifliche glaubt, vom Menschen nicht selbständig geleistet werden kann, also ausschließlich Geschenk der Gnade ist.
Parzivals Glaube ist ein Erweis, dass er die Gnade besitzt, dass sich die Verheißungen, die ihm auf seinen Lebensweg mitgegeben waren (vgl. o. S. 41), erfüllt haben. Die Eigenart dieses Glaubens aber deutet auf das Wesen der Gnade: dass sie a l l e s bewirkt, während der Mensch selbsttätig nichts vermag. Das gleiche zeigen die Verheißungen, die über Parzivals Leben ausgesprochen wurden und die sich immer erfüllten: Parzivals Leben war ganz von der Gnade geleitet; es war so, wie es sich ereignet hat, völlig von Gott bestimmt.
Nun ist aber Wolframs ‚Parzival’ keine Heiligenlegende, in der der Held alles Leid, das er erfährt, demütig auf sich nimmt und so die in ihm wirkende Gnade wunderbar erweist; er ist auch kein hymnischer Preis der göttlichen Gnade, die in Parzival so herrlich erschienen ist, sondern ein oft mit dramatischer Spannung erfüllter Roman, dessen Held sich mehr auf Irrwegen als auf dem rechten Weg befindet und dies, obgleich er ständig von der Gnade geleitet ist. So müssen also, nachdem dargelegt wurde, dass Wolfram das Leben seines Helden ganz unter die Gnade gestellt sieht, im Roman Hinweise gesucht werden, die erklären, warum nach Wolframs Meinung die Gnade so seltsame Wege führt. Fehlen solche Hinweise, so wird man darauf verzichten müssen, die eigenartige stiure, die den Verlauf der Erzählung bestimmt und die dieser Handlung oft tragische Züge gibt, mit einer Deutung der Wege Gottes in Zusammenhang zu bringen außer mit der, dass nach Wolframs Erkenntnis Gottes Wege wunderbar sind und nicht zu durchschauen, eine Deutung, an die auch Rupp denkt, wenn er schreibt: „Im ‚Parzival’ führt Gott den Menschen zu diesem Ziel, aber die Wege, die er führt, scheinen dem Menschen oft willkürlich. Denn Gott ist wohl ein Gott der Gnade und Treue, aber auch ein
Deus absconditus, der vom Menschen nicht zu begreifen ist."(332) (118)
|