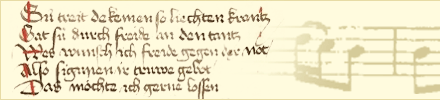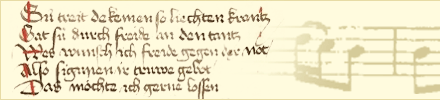2. KAPITEL
Parzivals Weg ins Artusrittertum
(Rechtfertigung des ritterlichen Ethos)
Es wurde bisher aufgezeigt, wie Wolfram die Verfehlungen, die er darstellt, versteht: Die Schuld, die der Mensch aufgrund dieser Verfehlungen auf sich lädt, ist nicht zurechenbar und darum auch nicht strafbar, da die Verfehlungen nicht einer freien Entscheidung für das Böse entspringen. Ursache jeder Verfehlung ist für Wolfram die tumpheit, nicht der böse Wille.
Die tumpheit wurde zu den Grundvorstellungen der christlichen Anthropologie in Beziehung gesetzt mit dem Ergebnis, dass sie als Index für die durch den Sündenfall aktualisierte Nichtigkeit aufzufassen sei. Da die Nichtigkeit nach dieser Anthropologie den Menschen wesenhaft bestimmt, muss die Verfehlung des Menschen als notwendig seinem Wesen entspringend angesehen werden.
Der Sündenfall wurde in zweifacher Hinsicht betrachtet: Einmal kann die durch den Sündenfall bewirkte Aktualisierung der Nichtigkeit als Strafe im Sinne von Vergeltung für diese Ursünde angesehen werden; dann müssen die dieser Nichtigkeit entspringenden Verfehlungen dem Menschen zugerechnet werden. Man kann aber auch Nichtigkeit für sich als Grundverfassung des Menschen betrachten, ohne sie dem Menschen unter ständigem Hinweis auf den Sündenfall als Strafe für zurechenbare Schuld anzulasten. Das Besondere von Wolframs Darstellung menschlicher Schuld führte zu der Vermutung, dass dem Roman Wolframs diese zweite Sicht auf die Erbsünde zugrunde liegt.
Mit dem Hinweis auf die für christliches Denken selbstverständliche Vorstellung, dass der Mensch nicht nur durch seine Nichtigkeit wesenhaft bestimmt ist, sondern auch durch Gott, an dessen Sein teilhabend der Mensch erst Bestand hat, stellte sich die Frage der Theodizee: Berücksichtigt man, dass der Mensch, der in Gott lebt, vor der Nichtigkeit und deren Folgen bewahrt bleibt, berücksichtigt man weiter, dass die Aktualisierung der Nichtigkeit als Folge der Trennung von Gott nicht als Vergeltung für eine ursprüngliche Schuld anzusehen, also nicht auf den Menschen zurückzuführen ist, so stellt sich mit der Folgerung, dass demnach der allmächtige Gott selbst die Ursache für die Trennung von ihm sei, die für den Roman zentrale Frage nach dem Wesen und den Absichten Gottes (vgl. 4. Kapitel).
Doch bevor diese Frage behandelt wird, sollen die Konturen des Menschenbildes, das dieser theologischen Konzeption zugrunde liegt und das im ersten (30) Kapitel als das Menschenbild Wolframs aufgezeigt wurde, durch Einzelinterpretationen klarer herausgearbeitet werden. Es soll das Ethos der Gestalten in Wolframs Roman untersucht und gezeigt werden, dass dieses Ethos christlich ist, d. h. dass das Handeln der Wolframschen Ritter deswegen ethisch gut ist, weil es von einem Standort aus geschieht, in dem der Mensch auf Gott als seinen Wesensgrund hin gerichtet ist. Ist für das Verhalten der Wolframschen Gestalten ein solcher Standort, ein solches Ethos nachgewiesen, so können deren Verfehlungen nicht auf einen strafbar bösen Willen zurückgeführt und ihnen nicht angelastet werden; sie können dann auch nicht als Zeichen der sündhaften Grundverfassung des Menschen, für die er verantwortlich sei, gedeutet werden. Parzivals Weg ins Artusrittertum soll im folgenden als Beispiel für den Weg zu diesem Ethos hin dargestellt werden.
Die Beurteilung dieses Wegs durch die Forschung
Diese Untersuchung wird um so notwendiger, weil ein Teil der ‚Parzival’-Interpreten ein anderes als das bisher erarbeitete Menschenbild ihrer Interpretation zugrunde legt. Diese Interpreten sehen Parzivals Weg ins Artusrittertum nicht von einer grundsätzlichen Zuwendung zu Gott hin geleitet, sondern begreifen ihn als einen Weg der Abkehr von Gott (aversio a deo): Folge einer sündhaft verkehrten Willensrichtung. Anstatt auf Gott richte sich der Wille auf d e n Seinsbereich, der durch Nichtigkeit bestimmt ist (vgl. o. S. 13), auf Ich und Welt (conversio ad creaturam). H. Kuhn spricht in diesem Zusammenhang von „metaphysischer Unorientiertheit"(48). J. Bumke deutet Parzivals Weg ins Artusrittertum als „Abstieg in die Sünde"(49). Da aber Parzival am Ende dieses Wegs als das Ideal des Artushofs gefeiert wird, muss diesen Forschern das ganze Artusrittertum und damit das Ethos, das durch dieses Rittertum repräsentiert wird, als verworfen gelten. Diesen Zusammenhang zwischen Parzivals Weg und Artusrittertum stellt am deutlichsten G. Weber her: „. . . im Symbol Parzival hat die ritterliche Welt versagt, ist der Ritter zusammengebrochen, der den Anspruch erhebt, eine gültige welthafte Seinsform im Christlichen geschaffen zu haben, also im weltlichen Sein auf christliche Weise existieren zu können"(50).
Eindringlich beschreibt P. Wapnewski Parzivals Weg ins Artusrittertum als eine sündhafte conversio ad creaturam: „Nicht Willenshingabe an Gott treibt ihn in die Welt, sondern um irdischer Erfüllung, die propter se erstrebt wird, um ritterlichen Ehrgeizes willen reitet er aus, bricht der Mutter das Herz, nimmt dem Roten Ritter das Leben: indem er jetzt in dessen Gestalt hineinwächst, selbst der Rote Ritter wird, legt er sich das von ihm erstrebte Gewand des Ritterdaseins um dieser Welt willen an. Denn der Rote Ritter war - und bleibt - Inbild der aventiurefrohen, minnefreudigen höfisch-diesseitigen Gesellschaft!"(51)
(31) Eine solche Beschreibung eines verfehlten Wegs unterscheidet sich wesentlich von Wolframs Darstellung menschlicher Schuld, wie sie im ersten Kapitel erläutert wurde: Wolframs Menschen handeln in bester Absicht; ihre Vergehen sind nicht bösem Willen, sondern ihrer tumpheit zuzuschreiben. Der von Wapnewski dargestellte Weg Parzivals in die ‚Sünde’ könnte zwar prinzipiell dem Wolframschen Verständnis von Schuld zugeordnet werden, wenn nämlich Parzival für die falsche Willensrichtung in keiner Weise verantwortlich gemacht würde; doch deuten die Formulierungen Wapnewskis darauf hin, dass er diesen Weg nicht als tragisches Sich-Vergehen verstanden haben möchte, sondern als zurechenbare, strafbare Schuld, dass er also Wolfram in die Tradition des Augustinismus einordnet. Auch J. Bumke versteht Wapnewski in diesem Sinne und bestätigt ihn: „. . . Wolframs Darstellung ist, wie Ehrismann, Maurer und vor allem Wapnewski gezeigt haben, aus der Sündenlehre Augustins zu verstehen"(52). Nach dieser Sündenlehre schafft „. . . wissentlich begangene Hauptsünde einen Zustand der Sündenstrafe . . ., der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sünder . . . unfähig wird, Gutes zu tun"(53). Demnach beginne für Wolfram „Parzivals Sünde mit dem Eintritt in die Welt und zeugt fortwirkend Sünde"(54). Die Beurteilung eines solchen Wegs ist für J. Bumke eindeutig:„. . . Wolfram hat durch Trevrizent keinen Zweifel an der Bewertung von Parzivals Sündenweg gelassen. Nichtwissen, ignorantia, tumpheit sind vor Gott keine Entschuldigung; Parzival trägt zwuo grôze sünde und ist verantwortlich für sie"(55).
Das Handeln des christlichen Ritters geschieht aus dem christlichen Ethos, d. h. aus einem Standort heraus, der in Gott gegründet ist (vgl. o. S. 30). Die Qualitäten des christlichen Ritters sind also nur dann ethisch zu nennen, wenn sie ihn befähigen, diesen Standort einzunehmen. Die ritterlichen Tugenden wie schame, mâze usw. sind demnach nur wertvoll, wenn sie zugleich christlich-religiöse Tugenden sind, wenn sie also das christliche Ethos garantieren.
Unter der Voraussetzung - die im folgenden noch zu belegen ist -, dass für Wolframs Roman ritterliche und religiöse Tugenden tatsächlich identisch sind, dass also die ritterlichen Tugenden für Wolfram immer schon christliche Tugenden sind, bedeutet ein Verstoß gegen die ritterlichen Tugenden zugleich auch den Verlust des christlichen Ethos und umgekehrt. Darum können den Interpreten, die Parzivals Weg ins Artusrittertum als strafbare Abkehr von Gott deuten, auch die zugeordnet werden, die mehr den moralischen Aspekt dieses Wegs betonen, indem sie Parzival „selbstische Gedanken"(56), „unbereinigten Geltungswillen des um sich selbst kreisenden Ichs"(57), „dumpf-ungeistige"(58), „tollpatschige"(59) „Selbstigkeit des Lebens-Begehrens"(58) vorwerfen. Der religiöse Aspekt solcher Verfehlung: sie bedeutet eine Umkehrung der von Gott gewollten Ordnung und geht hervor aus einer falschen Richtung des Willens; denn eine solche Haltung gründet (32) nicht in des Menschen Liebe zu Gott, die sich in der Liebe zum Nächsten manifestiert, sondern in der Liebe des Menschen zu sich selbst. So spricht Keferstein davon, dass Parzival das Ganze der „lebendigen Ordnung . . ., die die eine und ganze ritterliche Welt aus dem einen und ganzen Geiste der Nächstenliebe heraus formt"(60), verfehlt habe. Das der Nächstenliebe widersprechende ‚Selbstische’ Parzivals und des ganzen durch ihn repräsentierten Rittertums führt zu einer „Erstarrung der lebendigen Ethik des deutschen christlichen Ritters zu idealen und absolut gültigen Anstandsregeln, die nicht mehr auf die sie tragende und konstituierende ethisch-religiöse Grundkraft zurückbezogen werden"(61) - Keferstein denkt vor allem an Parzivals Versagen auf der Gralsburg. So verweist ein moralisch verfehltes Handeln auf den Verlust des christlichen Ethos: die „ethisch-religiöse Grundkraft„ ist verlorengegangen.
Die gleichen Vorstellungen formuliert G. Weber mit allzu zeitbedingten Begriffen. Für Kefersteins „Erstarrung der lebendigen Ethik . . . zu idealen und absolut gültigen Anstandsregeln„ steht bei Weber „formalästhetische Pseudosittlichkeit"(62), „hinter der sich Verfall und Morbidität breit machen"(63). Erklärt wird diese „Pseudosittlichkeit" durch eine „Intellektualität des gesellschaftlichen Formwillens"(64). Die entsprechenden Gegenbegriffe zu Intellektualität stellen sich für Weber leicht ein: Was Keferstein „ethisch-religiöse Grundkraft„ nennt, heißt bei ihm „feinste irrationale Schwingungen des Begnadeten"(64), „tiefste Schicht urhaften Empfindens"(64), „ethisches Urgefühl"(65), „christliches Urethos des Mitleids"(66) und „Caritasurschicht"(67).
Das angebliche Fehlverhalten Parzivals und des Artusrittertums bringt W. J. Schröder in Beziehung zu dem Dualismus zwischen weltlichem und göttlichem Sein mit dem Ergebnis, dass zwischen der ritterlichen Tauglichkeit des Artusrittertums und dem christlichen Ethos ein ontologisch zu begreifender Bruch bestehe: hier Welt-, dort Gottesliebe. Er folgert daraus - und hier ist er radikaler als die bisher erwähnten Interpreten -, dass sogar moralisch tadelfreies Verhalten Sünde sein könne, dann nämlich, wenn ihm der Bezug zu Gott fehle. Humanes Verhalten ohne Gott sei also wertlos, denn „die Wahrheit . . . ist, dass alles Menschliche durch Böses wurzelhaft verdorben und daher Gnade vonnöten ist“68. Diese Wahrheit zeige sich auf dem Weg Parzivals ins Artusrittertum: „Es ist der Irrtum des
verdorben und daher Gnade vonnöten ist“(68). Diese Wahrheit zeige sich auf dem Weg Parzivals ins Artusrittertum: „Es ist der Irrtum des tumben, der unter der naiven Voraussetzung der Möglichkeit immanent humaner Lebenserkenntnis und -gestaltung denkt und lebt, dessen Ausgriff ins Dasein daher als titanischer Weltwille am wahren Wesen der Welt im Sinne christlicher Ordovorstellung scheitern muss. Parzivals ‚Gott’, der ihm den Gral zu erringen helfen soll, ist in Wahrheit der Teufel . . ."(68)
Die oben kurz angedeuteten Interpretationen von Parzivals Weg ins Artusrittertum weisen auf die Methode hin, mit deren Hilfe das Bild, das Wolf(33)ram vom Menschen hat, weiter verdeutlicht werden kann. Im ersten Kapitel wurde Wolframs Menschenbild umrissen mit dem Nachweis, dass Wolfram seine Gestalten nicht für ihre Verfehlungen verantwortlich macht, sondern sie vielmehr mit dem Hinweis auf ihre tumpheit entschuldigt. In diesem Kapitel nun soll vor allem gezeigt werden, dass Parzivals Weg ins Artusrittertum nicht nur keine subjektive Verschuldung bedeutet, dass vielmehr nicht einmal von einer objektiven Verschuldung gesprochen werden kann, dass also dieser Weg als ein Weg zum christlichen Ethos hin bezeichnet werden muss, dass demnach die Irrtümer, die Parzival auf diesem Weg begeht, nicht den Weg als solchen diskreditieren.
Es muss also im folgenden gezeigt werden, wie Parzival auf dem Weg ins Artusrittertum von der ‚humanen Lebenserkenntnis und –gestaltung’ des Artusrittertums geprägt wird und wie diese im einzelnen bestimmt werden kann. Weiterhin muss belegt werden, dass diese ‚Lebenserkenntnis und -gestaltung’ nicht ‚immanent human’, sondern eindeutig christlich ist. Ist aber der Weg Parzivals ins Artusrittertum vom Text her als Weg zum christlichen Ethos hin erwiesen, so stellt sich die Frage, warum Parzival auf diesem Weg so entschieden scheitert, erneut und fordert eine Antwort, die anders ausfallen muss als die der oben zitierten Interpreten.
‚zuht’ und ‚art’
Eine prägnante Erklärung dieses Scheiterns gibt Vers 239,10: durch zuht in vrâgens doch verdrôz(68a). Parzival unterlässt die Frage, die Anfortas erlöst hätte, weil er durch seine zuht am Fragen gehindert wird. Aufgrund dieses Satzes gewinnt die zuht Parzivals zentrale Bedeutung für die Interpretation. Den Forschern, die Parzivals Weg ins Artusrittertum als einen Weg in die Sünde verstehen, wird zum Teil Parzivals Festhalten an der zubt, zum Teil die zuht selbst zum Inbegriff verfehlter menschlicher Haltung. Diese Auffassung soll im folgenden geprüft werden durch den Vergleich mit dem, was Wolframs Zeit allgemein und Wolfram speziell unter zuht verstehen.
zuht bedeutet im Mittelhochdeutschen soviel wie Erziehung und das, womit und wohin man erzieht, also Erziehungsmittel und Erziehungsziel(69). Im Zusammenhang der folgenden Untersuchung interessiert vor allem die letzte Bedeutung: zuht als Bezeichnung für ein Erziehungs-, Lebensideal, das durch eine Fülle von ethischen Werten näher bestimmt ist.
Über das Verhältnis zwischen Erziehung und zu Erziehendem stellt W. J. Schröder unter dem Aspekt der Belehrung folgende Theorie innerhalb seiner ,Parzival’-Interpretation auf: „Die Lehre schafft im Belehrten auf die (34) gleiche geheimnisvolle Weise das Sein, wie Gottes Wort aus dem Nichts die Welt schuf."(70) Dass außer Gott jemand im Menschen etwas aus dem Nichts erschafft, widerspricht christlicher Lehre. Nach dieser Lehre, die hier beeinflusst ist von der platonischen Philosophie, liegt das, was ein Mensch ist, als Idee von Ewigkeit her in Gottes Denken; bei der Schöpfung legt Gott diese Idee wie einen Samen (der neuplatonische lógos spermatikós) in den Menschen. Durch diesen Samen ist der Mensch von Anfang an festgelegt und bis ins Einzelne hinein bestimmt, so dass er nicht mehr durch menschliche Erziehung bestimmt werden könnte. Wolfram nennt diese von Gott in den Menschen hineingelegten Anlagen den art. Die Aufgabe des Erziehers besteht also lediglich darin, das im art Angelegte zu fördern, zu entfalten, so dass das Ergebnis dieser Erziehung nichts anderes ist als die Verwirklichung dessen, was als Möglichkeit im art schon angelegt war, was Gott als Samen in den Menschen hineingelegt hatte.
Als Beleg dafür, dass solche Überlegungen über das Verhältnis von Anlage und Erziehung dem Mittelalter gemäß sind, können einige Verse des Boethius dienen, denn Boethius zählt zu den großen Autoritäten, auf die sich das Mittelalter ununterbrochen beruft(71):
haeret profecto semen introrsum veri,
quod excitatur ventilante doctrina;
Tief innen birgt sich gewiss der Funke der Wahrheit,
der erregt wird, wenn die Lehre ihn anfacht.
(Cons. III, Metrum 11,11/12)(72)
Die Erziehung zur rechten Erkenntnis durch die Belehrung des Erziehers ist nichts anderes als die Entfaltung dessen, was von Gott im Menschen angelegt ist. Im selben Metrum verweist Boethius auf die platonische Anamnesislehre, die einer solchen Erziehungstheorie zugrunde liegt:
quod quisque discit, immemor recordatur.
Was jeder lernt: er erinnert sich des Vergessenen
(a. a. 0. V. 16).
Dass auch die hochhöfischen Dichter in dieser Weise das Verhältnis von Anlage und Erziehung sehen(73), belegen die Wendungen von arde ein zubt (Wh 213,5; Wh 416,2), zuht von art (Iwein 6292), sînr . . . art ein zuht (464,30); denn diese Wendungen sagen nichts anderes, als dass die Werte (zuht), zu denen der Mensch erzogen werden soll, schon in ihm angelegt (von arde) sind. Demnach kann man also auch d e m Menschen zuht zusprechen, der noch nicht erzogen ist, der aber das Erziehungsziel als Anlage in sich hat. Wenn Wolfram schließlich sogar Gott zuht zuspricht (148,26; 464,30), so wird vollends deutlich, dass er unter zuht nicht nur Erziehung und Erziehungsmittel, sondern auch einen Kanon von Werten versteht, den der, der (noch) nicht erzogen ist, schon von Natur aus (art) besitzt. (35)
Parzivals ‚art’
In der ‚Parzival'-Forschung wird nicht nur die ritterliche zuht verurteilt; es gibt auch Interpreten, die ebenfalls zwischen zuht und art ein enge Beziehung sehen und darum mit der zuht zugleich auch den art verurteilen. So meint H. Kuhn, Parzival sei nach dem „Gesetz der Sünde . . . angetreten"(74) und dieses Gesetz bestimme den Weg Parzivals ins Artusrittertum. Es wurde eben gezeigt, dass nach Wolframs Meinung im art des Menschen die Werte der ritterlichen zuht angelegt sind, so dass die Erziehung diese Werte nur zu entfalten braucht. Könnte weiterhin vom Text her belegt werden, dass dieser art von Gott geformt ist, dass also die in diesem art angelegten Werte in Gott ihren Ursprung haben, so wäre zunächst einmal die These widerlegt, dass Parzival nach dem Gesetz der Sünde angetreten sei; zugleich aber wären auch die Werte der zuht gerechtfertigt.
Diese Belege sind unschwer zu finden: Nach Ansicht des Erzählers hat Gott Parzival so vollkommen erschaffen, wie nur ein Mensch vollkommen sein kann:
got was an einer süezen zuht,
do'r Parzivâlen worhte (148,26/27); (74a)
darum erscheint Parzival als ein Mensch,
an dem got wunsches het erdâht (148,30). (74b)
Wer ihn anschaut, der weiß:
Dô lac diu gotes kunst an im (123,13).
Diese kunst, mit der Gott Parzivals art erschaffen hat, ist so augenfällig, dass jeder, der Parzival sieht, dessen art preisen muss:
deiswâr sô werdeclîche fruht
erkôs nie mîner ougen sehe.
an im lît der saelden spehe
mit reiner süezen hôhen art (164,12-15). (74c)
Man erkennt, dass Gott Parzival durch dessen art zu Höherem berufen hat:
ir tragt geschickede unde schîn,
ir mugt wol volkes hêrre sin.
ist hôch und hoeht sich iwer art (170,21-23).
Parzival besitzt also zuht von arde, denn er ist zu dieser Zeit noch nicht von Gurnemanz belehrt.
Die äußere Erscheinung gilt bei Wolfram immer als Zeichen des inneren Werts; darum verweist auch Parzivals Erscheinung darauf, dass er nicht nach dem Gesetz der Sünde angetreten ist, sondern als jemand, an dem got wunsches het erdâht, dass sein art begnadet ist und nicht verderbt. Er erscheint als
Aller manne schoene ein bluomen kranz (122,13) (75).
(36) Er ist der Schönste unter den Menschenkindern (Ps 45,3):
von der âventiure ich daz nim,
diu mich mit wârheit des beschiet.
nie mannes varwe baz geriet (76)
vor im sît Adâmes zît.
des wart sîn lob von wîben wît (123,14-18).
Und im Anklang an die Seligpreisung der Mutter Christi - Beatus venter, qui te portavit (Lk 11,27) - sagt Ither, den Parzival bald darauf töten wird:
gêret sî dîn süezer lîp:
dich brâht zer werlde ein reine wîp.
owol der muoter diu dich bar! (76a)ine gesach nie lîp sô wol gevar (146,5-8).
Ähnlich preist ein Ritter an Gurnemanz' Hof Herzeloyde:
wol doch der muoter diu in truoc (77),
an dem des wunsches lît genuoc (164,19/20).
Dieser Preis steigert sich noch, nachdem Parzival sein Torengewand ab- und prächtige modische Kleidung angelegt hat:
der ritter ieslîcher sprach,
sine gesaehen nie sô schoenen lîp.
mit triwen lobten si daz wîp,
diu gap der werlde alsölhe fruht (168,24-27)(78).
Für Wolfram ist Parzival also ein Bevorzugter Gottes, nicht aber ein Mensch, der von Anfang an den Weg der Sünde geht; er kann nicht als Symbol für die Menschheit gedeutet werden, die seit dem Sündenfall verderbt ist und außerhalb der Gnade lebt. Es ist darum nicht möglich, Parzivals
tumpheit und deren Folge als Zeichen einer grundsätzlichen Verderbnis der menschlichen Natur zu deuten, denn einer solchen Deutung widerspräche das Besondere von Parzivals art. Es ist aber auch nicht möglich, diese Verderbnis als eine zweite Stufe von Parzivals Leben zu konstruieren, wie W. J. Schröder es versucht, der Parzival zunächst in einen „Ort außerhalb des Daseins Daseins, das durch Streit und Kampf gefährdet ist“79, in einen „rein mythischen Raum des paradiesischen Seins“
Daseins, das durch Streit und Kampfgefährdet ist"(79) in einen"rein mythischen Raum des paradisieschen Seins"(80), in die „geschöpfliche Einheit mit Gott“(81) entrückt und dann einen Sündenfall konstruiert, zu dem Herzeloyde den Knaben verführt habe wie Eva den Adam. Denn ein Paradies ist Soltane, wo es Leid und Tod gibt, ebensowenig wie Herzeloyde, für die Wolfram nur lobende Worte findet(
82), eine Verführerin. Zudem preist Wolfram den art seines Helden auch dann noch, als Parzival Soltane verlassen hat.
Es lässt sich vom Text her keine wesentliche Veränderung des art und der durch diesen art bestimmten Haltung Parzivals belegen. Als Werk von (37) Gottes kunst ist dieser art unverändert gut und richtet Parzivals Lebensweg in jedem Augenblick des Romangeschehens auf das Gute hin aus. Da aber zunächst tumpheit diesen Lebensweg bestimmt, bleibt als theologische Erklärung eines solchen Wegs nur, dass Parzival wie jeder Mensch zwar durch die Erlösung gerechtfertigt und darum, wie sein art erweist, der Gnade Gottes voll teilhaftig ist, dass er aber zugleich doch immer unter dem Zwang der Sünde steht (vgl., o. S. 21f.), dass er also simul iustus et peccator (vgl. o. S. 22f.), zugleich tump unde wert (126,19) ist: wand an im sint beidiu teil,
des himels und der helle (1,8/9).
Während aber in der Zeit vor Wolfram das Sündigsein des Menschen, die Verderbtheit seiner Natur im Vordergrund stand, sieht Wolfram, wie die Handlungsführung des Romans und die Gestaltung seiner Personen beweisen, den Menschen grundsätzlich als den Erlösten, Begnadeten. Die durch die tumpheit angezeigte Aktualisierung der menschlichen Nichtigkeit gilt ihm als Ausnahmesituation. Darum vermeidet er auch, wie J. Schwietering bemerkt(83), das Wort natiure und ersetzt es durch art, weil natiure in der Literatur vor Wolfram soviel wie ‚böse Natur’ bedeuten kann.
Die Vorfahren als Vermittler des ‚art’
Zweierlei ist bisher über den art erarbeitet worden: 1. Der art des Menschen ist von Gott bestimmt; Gott prädestiniert durch diesen art den Lebensweg des Menschen. 2. Der art ist nicht sündhaft verdorben, sondern gut. Da aber nach Wolframs Vorstellung Gott den art nicht unmittelbar in jeden neuen Menschen hineinlegt, sondern vermittels der Vorfahren dieses Menschen - Wolfram umschreibt den art durch Wendungen wie geslaht, angeborn, geborn ze, von, uz, geerbet uf und gibt ihm die Attribute erborn, angeborn(84) -, bekommt die Herkunft eines Menschen entscheidende Bedeutung für seine Wesensart. Darum kann durch die Untersuchung dessen, was Parzival von seinen Vätern ererbt hat, weiterhin belegt werden, dass Parzival auf das Gute hin angelegt ist.
Parzival wird immer wieder ‚Gahmurets Sohn’ genannt, ja mit seinem Vater identisch gesetzt (109,25-27; 110,18-21; 113,13/14). Parzivals art ist also wesentlich durch das bestimmt, was er von seinem Vater ererbt hat. So schickt Wolfram, um die Eigenart Parzivals zu veranschaulichen, den Büchern über Parzival zwei über Parzivals Vater voraus.
Durch die Betrachtung von Gahmurets Leben könnte freilich zunächst die These, dass Parzival durch seine Herkunft auf das Gute hin angelegt ist, in Frage gestellt werden; denn Gahmuret erinnert den heutigen Leser an die Don Juan-Gestalt: zu drei Frauen (Belakane, Amphlise, Herzeloyde) stand er in enger Beziehung, und jede ließ er in Schmerz und Leid zurück. (38) Und es ist Ironie des Dichters, dass Gahmuret als Wappen den Anker wählt und dieses Wappen ablegt, als er glaubt, sein Anker habe Grund gefunden (99,13-15; vgl. 14,29-15,7; ähnlich Gottfried 8102-8104). In Wahrheit findet Gahmuret keinen Grund; sein ganzes Leben hindurch ist er ohne Ruhe auf Suche nach âventiure. Immer findet er leicht die Mittel, sich von den Fesseln, die ihn halten könnten, zu lösen:
sô kan ich noch den alten slich,(84a)als dô ich mînem wîbe entran (96,30-97,1),
so warnt er Herzeloyde, damit sie sich nicht zu fest an ihn binde. Der Zweifel an Gahmurets tugent wird noch bestärkt, wenn in Feirefiz der Rächer solcher ‚Treulosigkeit’ erscheint:
gein mînem vater der gerich (84b)
ist mînhalp noch unverkorn.
sîn wîp, von der ich wart geborn,
durh minne ein sterben nâch im kôs,
dô si minne an im verlôs (750,22-26).(85)
Für Gahmurets Verhältnis zu Amphlise treffen solche Anschuldigungen nicht zu, denn er war, da er am Turnier um Herzeloyde teilgenommen und es gewonnen hatte, verpflichtet, Amphlise zu verlassen und Herzeloyde zu heiraten (98,1/2). Doch dass Belakane, von ihm verlassen, aus Kummer stirbt und Herzeloyde voller Leid die Welt flieht, hat er verschuldet. Zwar war er eherechtlich nicht an Belakane gebunden(86), und zu Herzeloyde zurückzukehren hinderte ihn der Tod, doch bestanden keine zwingenden äußeren Umstände, die Frauen zu verlassen. Die Schuld an Leid und Tod dieser Frauen kommt also aus dem Charakter Gahmurets. Die Rechtfertigung Gahmurets und damit auch der Herkunft Parzivals kann darum nur durch den Nachweis geschehen, dass diese Schuld Gahmuret nicht zugerechnet werden kann.
Material für einen solchen Nachweis ist genügend zu finden: Der Erzähler selbst nennt Gahmuret der geliutrten triwe fundamint (740,6); und im Nachruf preist er ihn:
diu manlîche triwe sin
gît im ze himel liehten schîn (107,25/26);
der valsch was an im sîhte (107,28). (86a)
Auf Feirefiz' Anklage antwortet Parzival:
elliu missewende in vlôch (751,8);(86b)
dâ von der touf noch gêret ist
pflager, triwe ân wenken:
er kunde auch wol verkrenken
alle valschlîche tât:
herzen staete im gap den rât (751,12-16);(86c)
und auch sonst wird immer wieder von Gahmurets triuwe gesprochen (78,23; 90,9; 101,20; 110,8).
Die triuwe ist die Kerntugend der ritterlichen zuht (vgl. u. S. 47 ff.; S. 56 f.); sie ist die Grundlage jedes rechten Verhaltens. Da aber Gahmurets Handeln immer von triuwe geleitet ist, können ihm die leidvollen Folgen seines Verhaltens nicht als Schuld zugerechnet werden.
Folgerichtig führt Wolfram Gahmurets Veranlagung, die Frauen, denen er begegnet und die seiner würdig sind, an sich zu binden und dann auf Suche nach âventiure zu verlassen, nicht auf ein verderbtes Herz, sondern auf dessen Geschick zurück. Dieses Geschick ist ihm durch seine Herkunft bestimmt:
sîn art von der feien
muose minnen oder minne gern (96,20/21).(87) (87a)
Seine sene nach rîterschaft (54,18/19), die ihn hindert, in der minne Ruhe und Erfüllung zu finden (12,12-14), deutet Gahmuret selbst:
ich var durch mîne werdekeit
nâch ritterschaft in fremdiu lant.
frouwe, ez ist mir sus gewant (11,6-8). (87b)
Es ist also nicht Gewissenlosigkeit, die ihn die Frauen verlassen lässt, sondern sein art, der ihn in seinem Handeln bestimmt; für das Leid, das dadurch entsteht, dass er seiner Bestimmung treu bleibt (vgl. 16,1), kann er darum nicht verantwortlich gemacht werden(88). Im Blick auf die Anlagen, die Parzival von seinem Vater geerbt hat, ist Parzival also gerechtfertigt: Parzivals art, soweit er durch das väterliche Erbe bestimmt ist, ist gut, da Gahmuret nach Wolframs Ansicht ein vorbildlicher Ritter war.
Im einzelnen wird vor allem das Ergriffensein von der minne als väterliches Erbe bezeichnet.
nu bin ich doch ûz minne erborn (732,17).
Als Parzival Gurnemanz und dessen Tochter Liaze verlassen hat, berichtet der Erzähler:
sît er tumpheit âne wart,
done wolt in Gahmuretes art
denkens niht erlâzen
nâch der schoenen Lîâzen (179,23-26);(88a)
und als Parzival beim Anblick der drei Blutstropfen im Schnee an die Macht der minne verloren ist, erinnert der Erzähler an die, die Parzival beerbt hat:
ungezaltiu sippe in gar
schiet von den witzen sîne,
unde ûf gerbete pîne
von vater und von muoter art (300,16-19).(88b)
(40) Ebenfalls vom Vater geerbt hat Parzival die sene, die ihn treibt, das Ziel zu erreichen, zu dem er durch seinen von Gott geprägten art (vgl. o. S. 34) bestimmt ist. Durch seinen art ist Parzival zum Ritter bestimmt (ir mugt wol sîn von ritters art; 123,11), der die âventiure sucht und den Glanz und die Freude der Welt genießt. Diese Anlagen zeigen sich schon früh: Er schnitzt sich, ohne es gelernt zu haben, Pfeil und Bogen (118,4 f.) und geht auf die Jagd. Als er durch die süeze des Vogelgesangs (118,16) zum ersten Mal die Schönheit der Welt erfährt, spürt er seine Bestimmung:
daz erstracte im sîniu brüstelîn (118, 17),(88c)
und ein noch namenloses Sehnen (118,21/22) treibt ihn auf den Weg, zu dem er prädestiniert ist:
des twang in art und sîn gelust (118,28; vgl. 174,24),
so wie auch sein Vater durch seine sene nach rîterschaft (54,18/19) in die Fremde getrieben wurde:
min herze iedoch nâch hoehe strebet:
ine weiz war umbez alsus lebet,
daz mir swillet sus mîn winster brust.
owe war jaget mich mîn gelust? (9,23-26; vgl. 35,25-36,2). (88d)
Doch nicht nur die Sehnsucht und den Willen (13,15), das ihm bestimmte Ziel zu erreichen, erbt Parzival von Gahmuret, sondern auch die Tugenden, die ihn auf dem rechten Weg halten: die kiusche und die vrechheit (5,22). Die kiusche, der sophrosyne verwandt, lässt den Menschen das ihm Gemäße erkennen und verwirklichen(89) und bewahrt ihn davor, sein Ziel zu verfehlen. Sie zeigt sich bei Gahmuret u. a. als milte (9,10, 35,15-19), Bescheidenheit (12,23-25), Aufrichtigkeit (12,16), Dankbarkeit (12,19-22). Die vrechheit, manheit (9,11; vgl. andréia), die bei Wolfram häufig mit der kiusche gepaart erscheint(90), überwindet die Furcht vor den Schwierigkeiten, die sich auf diesem Weg entgegenstellen und die den Menschen verführen könnten, das Ziel, anstatt es zu erkämpfen (21,29-22,2; 86,3), aus den Augen zu verlieren und auf halbem Weg stehen zu bleiben. Zeichen dieser Tugenden aber sind Schönheit (36,19; 63,16-23) und
prîs:
sîn prîs gap s' hôhen ruc,
niemen reichet an sîn zil,
swâ man noch ritter prüeven wil (108,12-14).(90a)
Gahmurets Tauglichkeiten liegen in Parzivals art und garantieren, dass Parzival auf dem Weg zu seinem Ziel sich immer von den besten Absichten bestimmen lässt und dass er dieses Ziel nie aus den Augen verliert und sich durch nichts von ihm abhalten lässt. Vor allem die Tapferkeit (mannes manheit alsô sleht; 4,12) wird als Erbteil Gahmurets betont; so heißt es von Parzival:
den twanc diu Gahmuretes art
und an geborniu manheit (174,24/25).
(41) Durch diese manheit beharrt Parzivals Denken und Wollen (muot) trotz aller Gefährdung unverzagt bei dem gesetzten Ziel; durch sie wird dieser muot zum unverzaget mannes muot (1,5)(91). Da aber letztlich Gott es ist, der solche Anlagen vermittels der Vorfahren in den Menschen hineinlegt, ist auch diese Tapferkeit, die sich durch nichts abschrecken lässt, beharrlich den Weg zu Ende zu gehen, nicht des Menschen eigene Leistung, sondern Geschenk der Gnade Gottes:
got was an einer süezen zuht,
do'r Parzivâlen worhte,
der vreise wênec vorhte (148,26-28).(91a)
Das letzte Ziel Parzivals ist nicht das Artusrittertum, sondern das Gralskönigtum. Diese Bestimmung ist ihm durch die Mutter vermittelt, denn Herzeloyde ist eine Tochter des Gralskönigs Frimutel; durch sie wird er zum Miterben des Grals:
er was ouch ganerbe dar (333,30).(92)
Diese Berufung hebt ihn zwar aus der Reihe der übrigen Ritter heraus; er wird darum oft mit Worten gepriesen, die über das hinausgehen, was sonst von einem vorbildlichen Ritter gesagt wird: deiswâr du wirst noch saelden (92a) rîch (139,28), sagt ihm Sigune; auch die Gralsritter nennen ihn saelden rîch (227,30). Den Artusrittern muss eine solch begnadete Gestalt wie ein Engel erscheinen:
Dô truoc der junge Parzivâl
âne flügel engels mâl
sus geblüet ûf der erden (308,1-3).(92b)
Doch die von Gahmuret ererbten ritterlichen Tauglichkeiten hindern ihn nicht auf dem Weg zu diesem höchsten Ziel, sondern ermöglichen erst diesen Weg: ohne die kiusche und den unverzaget mannes muot hätte der ûz erkorne (619,14) jenes Ziel nicht erreichen können.
Der Beginn des Wegs ins Artusrittertum: Ausritt aus Soltane
In der Forschung ist Parzivals Ausritt aus Soltane zum Teil negativ beurteilt worden: " ... . . nur ein triebhaftes Gelüst, an den . . . Ritterhof zu eilen«(93), bestimme Parzival bei seinem Ausritt. Es ist aber deutlich geworden, dass nicht sündhafter amor mundi zum Ausritt drängt, sondern dass der von Gott geformte und durch die Eltern vermittelte art ihn zum Ritter bestimmt hat (vgl. o. S. 40) und Parzival darum Soltane verlassen muss. Da also dem Ausritt Parzivals kein Makel anhaftet, kann der Erzähler seinem Helden Glück auf diesem Weg wünschen:
doch solten nu getriwiu wîp
heiles wünschen disem knabn,
der sich hie von ir hât erhabn (129,2-4).
(42) Nicht der Ausritt Parzivals ist verfehlt, wohl aber der Versuch Herzeloydes, den Sohn an der Entfaltung seines von Gott gegebenen arts zu hindern: „Was die Mutter wollte, war unnatürlich"(94), d. h. es entsprach nicht Parzivals art. Für den Erzähler ist Herzeloydes ängstliche Sorge um den Sohn Betrug an dessen art:
der knappe alsus verborgen wart
zer waste in Soltâne erzogn,
an küneclîcher fuore betrogn (117,30-118,2).(94a)
Diese Fehlentscheidung ist für Wolfram, da sie die von Gott gesetzte Ständeordnung stört(95), von solcher Bedeutung, dass er im ‚Willehalm’, wo Rennewart ebenfalls um seine edelkeit betrogen wird, noch einmal an Parzival (271,18) erinnert:
ir neweder was nâch arde erzogn: (95a)
des was ir edelkeit betrogn (271,25/26).
W. J. Schröder freilich verkehrt diese ‚Verfehlung’ Herzeloydes ins Gegenteil. Dazu verweist er zunächst auf einen Widerspruch in Herzeloydes Haltung: dass sie Parzival in ein Torengewand kleidet, damit er, von der Welt verlacht, bald wieder zu ihr zurückkehre, und dass sie ihm zugleich Lehren mit auf den Weg gibt, die ihn zum vorbildlich christlichen Ritter erziehen sollen. Diesen Widerspruch, der sehr „krass"(96) sei, interpretiert Schröder allegorisch-heilsgeschichtlich, indem er in Herzeloyde das Analogon Evas und Marias zugleich sieht. Nun sei es aber nicht Herzeloyde-Eva, die Parzival küneclîche fuore und edelkeit vorenthalten will, sondern Herzeloyde-Maria, indem sie Parzival „in der geschöpflichen Einheit mit Gott„ halte (vgl. o. S. 36). Wenn aber Herzeloyde den Sohn über Gott und den Teufel belehre, so sei sie Analogon Evas: Parzival esse, von Herzeloyde verführt, vom Baume der Erkenntnis, d. h. er falle in die Sünde, sei durch seine Mutter im Zustand des „sündigen Menschen ganz im Sinne Adams nach dem Essen der Frucht"(97). Die Gottesvorstellung, die sie ihn lehre, sei aber in Wahrheit das Götzenbild der Heiden: dieser Gott sei nichts als der Teufel selbst (vgl. o. S. 32).
Diese Interpretation kann vom Text her nicht belegt werden (vgl. o. S. 36). Zwar wird Herzeloyde schuldig, nicht durch ihre Lehre, sondern durch den Versuch, die Entfaltung von Parzivals art zu verhindern; denn eine Erziehung, die den „durch beide Eltern vererbten natürlichen Anlagen nicht gerecht wird"(98), ist falsch, da sie dem Willen Gottes widerspricht (der site fuor angestlîche vart - Diese Erziehung fuhr eine enge, bedrängnisvolle Fahrt, d. h. sie musste scheitern(99); 117,29). Doch wenn auch Herzeloyde objektiv die von Gott gewollte Ordnung verfehlt, so ist ihr dies nicht als Schuld zuzurechnen, denn die Motive ihres Handelns kommen aus lauterer Güte (128,23-28).
(43) In der Ritterwelt, für die Parzival durch seinen art bestimmt ist, gibt es nicht nur Glanz und Freude, wie sie der Artushof zeigt, sondern auch Leid und Not:
sus lônt iedoch diu ritterschaft:
ir zagel ist jâmerstricke haft (177,25/26).(99a)
So hat es Gurnemanz, der um seine gefallenen Söhne trauert, erfahren. Und auch Herzeloyde trägt schwer an der Last des Leids, das ihr vom Rittertum kommt:
si truoc der freuden mangels last (116,30);
ein nebel was ir diu sunne:
si vlôch der werlde wunne.
ir was gelîch naht unt der tac:
ir herze niht wan jâmers phlac (117,3-6).
Sie verlässt die Welt, in der sie als Königin über drei Länder in großem Glanz hätte herrschen können, in der sie aber mehr Leid als Glück erfahren hat, und nimmt freiwillig Armut auf sich, um ihr Kind vor dieser leidbringenden Welt, vor der rîterschaft, die trûrens urhap ist(100), zu bewahren; und Wolfram rühmt eine solche triuwe:
swer die (die armuot) durch triwe lîdet,
hellefiwer die sêle mîdet.
die dolte ein wîp durch triuwe:
des wart ir gâbe niuwe
ze himel mit endelôser gebe (116,17-2 1). (100a)
Es wächst also die Schuld aus einer Tugend (vgl. o. S. 8): die triuwe Herzeloydes führt zur Verkennung der gemäßen Ordnung. Doch Herzeloyde kann für diese Verkennung nicht verantwortlich gemacht und nicht gestraft werden; ihre Schuld ist die Schuld einer Unschuldigen; darüber lässt Wolfram keinen Zweifel.
Herzeloyde entspricht also völlig der Vorstellung, die Wolfram vom Geschick des Menschen hat; Schröders Zweiteilung dieser Gestalt in Eva und Maria würde diese Geschlossenheit nur stören. Da aber Schröders Interpretation unzutreffend ist, muss der Widerspruch zwischen Torengewand und Lehre, der Schröder zu seiner Deutung veranlasst hat, in anderer Weise erklärt werden: Parzival drängt in die Welt, in der er seinen art entfalten, in der er sich bewähren möchte, selbst wenn er dabei gefährdet ist. Die Mutter, die diese Gefährdungen kennt, will nichts als die Geborgenheit des Sohnes und glaubt, dass diese in Soltane am ehesten gegeben sei. Der letzte, verzweifelte Versuch, ihn in dieser Geborgenheit zu halten, ist das Torengewand, das sie ihm anlegt. Doch zugleich weiß sie, dass dieser Versuch umsonst ist; sie weiß, dass das Erbe des Vaters den Sohn aus dieser Geborgenheit drängt; denn sie konnte beobachten, wie Parzivals art sich (44) allmählich durchsetzte, wie er sich Pfeil und Bogen schnitzte (118,4) und auf die Jagd ging (vgl. o. S. 40), wie seine sene nach rîterschaft (vgl. o. S. 40) durch die Begegnung mit den Rittern unbezwinglich geworden war. Und da sie weiß, dass sie ihren Sohn vor der rîterschaft nicht bewahren kann, bricht sie bei seinem Ausritt tot zusammen. Auf die Rückkehr des Sohnes hatte sie gehofft, obwohl sie wusste, dass diese Hoffnung sinnlos war; und weil sie dies wusste, hatte sie getan, was ihr allein zu tun übrig blieb, um den Sohn, der ihre Geborgenheit verlassen musste, nun doch noch, so weit es ihr möglich war, vor den Gefährdungen der Welt zu schützen: sie gibt ihm Lehren mit auf den Weg, wie er sich in der Welt verhalten und an wen er sich halten solle. Der Widerspruch in Herzeloydes Tun kommt also aus der Verzweiflung eines lebendigen Herzens und belegt, dass Wolfram seine Gestalten mit psychologischem Einfühlungsvermögen geschaffen hat(101).
Herzeloydes Gotteslehre
Parzivals art, der ihn ins Artusrittertum treibt, kann nicht böse sein, da die, durch die sein art bestimmt ist, seine Eltern, ohne Tadel sind. Parzival hat aber nicht nur von seinen Eltern gute Anlagen geerbt, sondern erhält durch Herzeloyde und später durch Gurnemanz, der Vaterstelle an ihm vertritt(102), auch die Belehrung, die diese Anlagen entfaltet (vgl. o. S. 34). Eine Untersuchung dieser Belehrung soll erweisen, dass Parzival durch sie nicht, wie Schröder von Herzeloydes Gotteslehre meint (vgl. o. S. 42), verführt werde, sondern auf den Weg geführt wird, zu dem er von Gott durch seinen art berufen ist.
Schröders Ansicht, dass Herzeloydes Gott in Wahrheit der Teufel sei, ist die extreme Formulierung einer Meinung, die in der ‚Parzival’-Forschung oft vertreten wird: dass Parzivals Christlichkeit verfehlt sei und Parzival darum scheitern müsse (vgl. u. S. 48). G. Weber z. B. argumentiert in dieser Weise und wertet darum Herzeloydes Lehre ab. L. Wolff widerspricht dieser These Webers; sie stehe im Widerspruch zu Wolframs Dichtung: es sei nicht im Sinne des Dichters, wenn man sie (Herzeloyde) so im Lichte des Unzureichenden . . . sehen soll, und wenn es mit an den Mängeln ihrer Unterweisung liegen soll, dass Parzival später scheitert"
(103). Dass es nicht im Sinne Wolframs sein kann, Fehler Parzivals durch Fehler Herzeloydes zu erklären, beweisen seine Aussagen über Herzeloyde, z. B. die über ihre diemuot (113,16; vgl. Anm. 82) und triuwe (vgl. o. S. 43). Und auch der Auffassung Schröders, dass Herzeloydes „Gottesvorstellung . . . nicht die christliche (sei), sondern diejenige, die man sich damals von dem ‚natürlichen’ Gottesglauben der Ungetauften machte"(104), widerspricht der Text in wünschenswerter Deutlichkeit.
(45) Eindeutig christlich sind z. B. Herzeloydes Aussagen über Maria und Christus:
diu hoehste küneginne
Jêsus ir brüste bôt,
der sît durch uns vil scharpfen tôt
ame kriuze mennischlîche enphienc (104a)und sîne triwe an uns begienc (113,18-22).
Und dass Herzeloyde ihrem Sohn dieses Wissen über die Erlösungstat Christi vorenthalten könnte, ist unwahrscheinlich, zumal sie ausdrücklich auf den Ernst und die Bedeutung ihrer Belehrung hinweist:
sun, ich sage dirz âne spot (119,18).(104b)
Am Beginn von Herzeloydes Lehre steht eine Aussage über Gott, die mit Hilfe der in der christlichen Theologie gebräuchlichen Lichtmetaphorik (vgl. o. S. 13
f.) formuliert ist:
er ist noch liehter denne der tac (119,19)(105);
Deus lux est, et tenebrae in eo non sunt ullae - Gott ist Licht, Finsternis ist nicht in ihm (1. Joh 1,5). In theologisch-philosophische Begrifflichkeit übertragen heißt dies: Gott ist das Gute, Vollkommene; Gott ist die Wahrheit und der wahre Erkenntnisgrund; Gott ist das Heil des ewigen Lebens. N i c h t ist Gott das Böse und Unvollkommene, nicht Verblendung und Lüge, Verdammnis und Tod; böse, verblendet, lügnerisch ist der Satan:
sô heizet einr der helle wirt:
der ist swarz, untriwe in niht verbirt (119,25/26).(105a)
Zu diesen beiden Seinsweisen gehören entsprechend die Menschen: die Sünder, die in der Finsternis wandeln (1. Joh 1,6 f.) und die Guten: die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit (Eph 5,9). Indem Wolfram Herzeloyde diesen Dualismus aussprechen lässt, eröffnet er in symbolischer Verkürzung den ganzen Horizont der christlichen Heilslehre:
sîn muoter underschiet im gar
daz vinster unt daz lieht gevar (119,29/30);(105b)
Wolff übersetzt underschiet im gar mit: „gab ihm darüber vollständige Unterweisung"(106); sie sagt ihm also über dieses Thema noch sehr viel mehr(107) als die wenigen Grundgedanken, die der Dichter ihr in den Mund legt.
Es gehört zur Verfahrensweise des Dichters, dass er vielfältige Erfahrungen und ausgedehnte Überlegungen in symbolische Handlungen, Bilder und Reflexionen zusammenzieht, dass also selbst begriffliche Reflexionen symbolisch verkürzt in der Dichtung erscheinen können. Da aber diese Handlungen, Bilder und Reflexionen durch den Zusammenhang, in dem sie untereinander stehen, vielfältig sich gegenseitig spiegeln und deuten, ist z. B. (46) die Knappheit der Reflexionen - das gilt auch für Herzeloydes Katechese - weder eine schlimme Vereinfachung noch - im Falle Herzeloydes - pädagogische Absicht (eine „ausführliche Belehrung . . . müsste am Kind abgleiten und sein Verständnis überschreiten"(108), sondern die legitime Weise des Dichters, das symbolisch anzudeuten, was in wissenschaftlicher Ausführlichkeit zu schreiben nicht seine Absicht sein kann. Wenn man aber Herzeloydes Lehre nicht aus dem Zusammenhang der Dichtung herausnimmt, sondern sie zu den anderen entsprechenden Stellen des Romans in Beziehung setzt, so ist diese Lehre als christliche Lehre nicht zu verkennen; bedenkt man darüber hinaus, dass der mittelalterliche Zuhörer Wolframs über diese Lehre weit selbstverständlicher als der moderne Leser verfügte, so darf man gewiss sein, dass für ihn durch die beiden Verse, die Gott als den bezeichnen,
der antlitzes sich bewac
nach menschen antlitze (119,20/2 1) 109a (109),
der ganze Horizont der Heilsgeschichte aufgerissen war. Sie erinnerten ihn daran, dass seit dem Sündenfall die Menschen abgrundtief von Gott getrennt und darum Kinder der Finsternis (1. Thess 5,4) waren und dass Gott ihnen seine unendliche Liebe erwies, indem er sie durch die Menschwerdung, den Tod und die Auferstehung seines Sohnes wieder an seiner Gnade teilhaben ließ.
Sieht man also solche Verse im Zusammenhang der Dichtung, dann ist ein Fehlurteil wie das Schröders nicht möglich. Ihm, der schon im Dualismus von Licht und Finsternis ausschließlich heidnisches Gedankengut finden will, sind diese Verse ein Hinweis darauf, dass die Heidengötter ihre Gestalt verwandeln können(110). Eine solche Interpretation der Worte Herzeloydes lässt sich korrigieren, wenn man sie neben das hält, was Herzeloyde früher schon über Jesus gesagt hatte:
der sît durch uns vil scharpfen tôt
ame kriuze mennischlîche enphienc (110a)
und sîne triwe an uns begienc (113,20-22; vgl. o. S. 45).
Wie Schröder und Weber glaubt auch H. de Boor, Herzeloydes Lehre sei unzulänglich, und übersieht darum den theologischen Hintergrund, auf den die durch den Rhythmus so bedeutsam hervorgehobenen Verse
der antlitzes sich bewac
nach menschen antlitze (119,20/2 1) (110b)
verweisen, dass nämlich Gott seinen Sohn in die Welt senden musste, weil der Mensch aus eigener Kraft nicht mehr zu Gott kommen konnte. De Boor meint: „Es fehlen wesentlichste christliche Begriffe: Sünde, Reue, Erbarmen, Liebe, Erlösung. Unerfasst bleibt für solches Denken der unendliche Abstand zwischen Mensch und Gott, die völlige Aufgegebenheit des Menschen in Gottes Willen, Führung und Gnade."(111)
(47) Nun steht aber im Mittelpunkt der Belehrung Herzeloydes das Wort von der triuwe Gottes:
sîn triwe der werlde ie helfe bôt (119,24),
und es fragt sich, ob nicht in diesem Wort die Begriffe der Gnade, der Liebe und des Erbarmens, die de Boor vermisst, versammelt sind.
,triuwe' als Grundbegriff der Wolframschen Christlichkeit
Der Begriff der triuwe ist eng verknüpft mit dem Vasallentum des Mittelalters: der Lehnsmann begibt sich freiwillig in den Dienst (meist Waffendienst) des Lehnsherrn. Für diesen Dienst erwartet er als Lohn Schutz und Unterhalt.
Da das Verhältnis zwischen Lehnsherr und Lehnsmann das zweier freier Menschen ist, kann es nur durch einen T r e u e eid gesichert werden, denn eine freiwillig eingegangene Bindung hat ihren eigentlichen Halt in der Treue. Und wenn auch immer schon dieses Treueverhältnis rechtlich abgesichert wurde, so bleibt doch das Ideal der triuwe als ‚Ideologie’(112) im Hintergrund aller rechtlichen Bestimmungen und macht in der klassischen Zeit des westeuropäischen Lehnswesens (10. - 13. Jh.) das Wesen jener Bindung aus.
Die wesentlichste Stütze aber fand diese Treueidee im Christentum, und zwar nicht nur dadurch, dass der Treueeid auf eine res sacra geschworen und dadurch gesichert war (vgl. 269,2), sondern vor allem, weil das Verhältnis zwischen Gott und Mensch als das Vor-bild des Verhältnisses zwischen Lehnsherr und Lehnsmann gesehen wurde.
Der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, ist garantiert durch Gottes Treue (113). In dieser Treue Gottes erweist sich seine Güte, seine Liebe, sein Erbarmen, so dass Güte und Treue im Alten Testament fast synonym gebraucht werden.(114) Die Antwort des Menschen auf diese Treue ist das zuverlässige Festhalten an diesem Bund mit Gott (Is 38,3; Jos 24,24), das sich im Neuen Testament vor allem im Glauben (fides) (115) zeigt (2. Thess 1,4): So bedeutet das Wort fidem servavi (2. Tim 4,7) sowohl ‚ich habe den Glauben’ als auch ‚ich habe die Treue bewahrt’(116).
Das Gott-Mensch-Verhältnis hat nicht nur den Charakter des Lehnswesens beeinflusst; die Beeinflussung hat wechselseitig stattgefunden: Die Vorstellung vom Gott-Mensch-Verhältnis wurde im Mittelalter durch die Formen des Lehnswesens geprägt. Gott wurde als Lehnsherr angesehen, der dem, der in Treue in seinem Dienst steht, Schutz und Hilfe gewährt. Damit wird die helfe Gottes zum Mittelpunkt des Treuebündnisses zwischen Mensch und Gott(117):
sîn triwe der werlde ie helfe bôt (119,24).
(48) Das immer (118) bedeutet: Gott lässt nie zu, dass der Mensch seine Hilfe verliert, indem das Bündnis zerbricht. Es weist somit wieder auf die Theodizee; denn Schuld und Leid des Menschen gehören demnach zur Erfüllung der Bundestreue Gottes.
Auf dieser Übertragung der Beziehung von Lehnsherr zu Lehnsmann auf das Gott-Mensch-Verhältnis gründet die Interpretation eines Teils der ,Parzival’-Forscher: Parzivals Christlichkeit sei verfehlt, weil diese Christlichkeit vom Lehnswesen geprägt sei; die Formen des Lehnswesens würden, übertragen auf das Gott-Mensch-Verhältnis, die ‚wahre’ Christlichkeit verdecken bzw. entstellen, da sie die Religion zu einem gegenseitigen Verrechnen von Dienst und Lohn erstarren ließen, wobei der Dienst aufgrund des Lohns zum Verdienst wird: „Parzivals Vorstellungen von Gottes helfe klingen noch absonderlich und sind noch im ritterlichen Denken befangen."(119) Parzivals Entwicklung sei dadurch bestimmt, dass er diese Verstellungen überwinde. So glaubt Halbach, dass Parzival bei Trevrizent „vom göttlichen Ritter-Gefolgsherrn zum christlichen triuwe-Gott sich hinfindet"(120), und Wessels meint, dass im 9. Buch „eine neue, zutiefst christliche Gottesvorstellung . . . das anthropomorphe Gottesbild verdrängt"(121). Parzivals zwîvel sei durch dieses falsche, durch Herzeloyde vermittelte Gottesbild erklärt.
Richtig ist, dass die christliche Religion immer in der Gefahr stand, zum bloßen Verrechnen von Verdienst und Lohn herabzusinken (vgl. Ablass) (122), falsch jedoch, Wolfram eine Kritik an solcher Religiosität zu unterstellen. Für Wolfram ist diese juridische Auffassung von Religion nicht zum Problem geworden; darum kann er die Vorstellung von Dienst und Lohn, anknüpfend an eine Fülle von Christusworten(123), auch dem in den Mund legen, von dem die oben zitierten Forscher meinen, er lehre Parzival die Überwindung solcher Vorstellungen: Für Trevrizent ist das Gott-Mensch-Verhältnis durch die Vorstellung von Lohn und Dienst bestimmt; ihm ist Gott der, der hilft, wand er helfen sol (461,30), der dem Menschen hilft, weil er durch seine
triuwe dem Menschen zu helfen verpflichtet ist; wie ein Lehnsherr hat Gott dem, der ihm dient, beizustehn. Gott wird also als der gesehen,
der nihtes ungelônet lât,
der missewende noch der tugent (467,14/15).
Dass Parzival, der mit diesen Worten Trevrizents Gotteslehre zusammenfasst, seinen Oheim nicht missverstanden hat, belegen die Worte des Grauen Ritters, der ganz unter dem Einfluss Trevrizents steht: für Kahenis ist Gott der,
der staeten lôn nâch dienste gît (449,18) (124).(124a)
(49) Unproblematisch sind für Wolfram die Begriffe lôn und dienst, da sie für ihn ein anderes als ein nur juridisches Gepräge haben. Es wurde schon darauf hingewiesen, wie dem Roman die Vorstellung zugrunde liegt, dass Gottes Güte alles bewirkt (vgl. o. S. 16). So ist der Bund zwischen Gott und Mensch ausschließlich das Werk Gottes (vgl. o. S. 47). Auch das Verdienst des Menschen, dem Gott in seiner Treue mit seiner
helfe
antwortet, ist im Grunde Leistung Gottes:
Tanta . . . est erga omnes homines bonitas Dei, ut nostra velit esse merita, quae sunt ipsius dona . . . –
‚So groß ... ist die Güte Gottes zu allen Menschen, dass er uns das als Verdienst anrechnet, was im Grunde seine Gnade ist’ (125). Gottes Antwort auf den Dienst des Menschen ist darum ‚Gnadenlohn’ (126).
Wie aber ist ein solcher Bund denkbar, den der Mensch nie verlassen kann, an dessen Zusammenhalt der Mensch kein Verdienst hat, so dass von Leistung und Gegenleistung, Verdienst und Lohn im eigentlichen Sinn nicht gesprochen werden kann? Und wie verträgt sich ein solches Bündnis, in dem der Mensch selbstverständlich immer schon lebt und das er nie brechen kann, mit der Freiheit, die wesentlich zu einem Treueverhältnis dazugehört (vgl. o. S. 47)?
Zur Lösung dieser Frage trägt die Beobachtung bei, dass Gott von Wolfram als der wâre minnaere (466,1) (127) bezeichnet und dass die minne von ihm mit der triuwe identisch gesetzt wird:
reht minne ist wâriu triuwe (532,10; 532,17/18).
Zu dieser Gleichsetzung passt die andere Aussage über Gott, dass er ein triuwe (462,19) sei. Dieses Wort Wolframs ist als Anklang an das Johanneische Deus est charitas (1. Joh 4,16) verstanden worden. Die Berechtigung, das Wort triuwe in die Nähe der neutestamentlichen charitas zu rücken(128), ist durch Wolframs Kennzeichnung Gottes als minnaere und als ein triuwe gegeben. triuwe bezeichnet also die Liebe Gottes, die in Christus offenbar wird (an Kriste ist triwe erkennet 752,30; vgl. 113,22), und die Liebe des Menschen zu Gott: der touf sol lêren triuwe (752,27); die triuwe begründet Wert und Ansehen des Christen (751,12/13). Eine Differenzierung und inhaltliche Ausfüllung des Begriffs triuwe kann, nachdem seine Nähe zur neutestamentlichen charitas deutlich geworden ist, erreicht werden, wenn man ihn durch die Vorstellung bestimmt, die Paulus mit charitas verbindet (z. B. 1. Kor 13).
Der Bund zwischen Gott und Mensch, so wie er von Wolfram gesehen wird, ist also ein Bund der Liebe. In einem solchen Bund ist aber der dienst nicht ohne weiteres Verdienst, auf Grund dessen der lôn im Sinne juridischer Vorstellungen eingefordert werden könnte, sondern der Dienst wird aus Liebe getan, und der Lohn der Liebe kommt jedem Verdienst zuvor.
Durch die Annäherung des Begriffs triuwe an die neutestamentliche charitas wird aber nicht nur das dienst-lôn-Verhältnis von seinem juridischen Gepräge befreit, sondern auch die Vorstellung verständlich, dass des Menschen (50) Treue zu Gott nicht dessen Leistung, sondern Tat des alles bewirkenden Gottes ist und dass der Mensch dennoch nicht unter Zwang Gott anhängt. Denn triuwe bedeutet nun, dass des Menschen Treue zu Gott von seiner Liebe zu ihm gehalten ist. Augustinus spricht vom ‚Gewicht der Liebe’, das den Willen des Menschen zu dem hinzieht, bei dem der Mensch allein Bestand hat: pondus meum amor meus, eo feror, quocumque feror (conf. XIII,9,10).
Diese Liebe aber wird entzündet durch die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes: Aus der Herrlichkeit Gottes kommt dem Menschen die Kraft, Gott in triuwe anzuhängen (vgl. 2. Petr. 1,3). ex Dei notitia (venit in te) Dei . . . amor(129).
Aber auch diese Erkenntnis Gottes, aus der die Kraft der triuwe kommt, ist nicht des Menschen eigene Leistung. Denn Erkenntnis ohne Liebe ist nichts (1. Kor 13,2; vgl. 1. Kor 8,1-3) (130). Der Liebe, die die Erkenntnis ermöglicht (131), muss aber die Selbstoffenbarung des Geliebten vorausgehn. Die Liebe des Menschen zu Gott ist darum erst die Folge der Offenbarung der Liebe Gottes (2. Kor 4,6). Dieser Gedanke, dass Gott die sich selbst offenbarende und dadurch die triuwe des Menschen erst begründende triuwe sei, bestätigt wieder die Vorstellung von der Allwirksamkeit Gottes, dass also der Mensch ohne die helfe Gottes nichts vermag.
Herzeloydes Wort von der triuwe Gottes, die der werlde ie helfe bôt (119,24), trifft somit den Kern der christlichen Religion(132). Die Verwandtschaft der religiösen Vorstellungen mit den Vorstellungen des Lehnswesens kann folglich nicht die Christlichkeit, in der Parzival auf dem Weg ins Artusrittertum lebt, entstellt haben. Vielmehr hat die Analogie des Gott-Mensch-Verhältnisses zum Lehnsherr-Vasall-Verhältnis dem Lehnswesen in Wolframs Augen einen solch hohen Rang verliehen, dass Wolfram nicht zu zögern brauchte, in der durch das Lehnswesen gegebenen weltlichen Ordnung das Abbild der göttlichen Ordnung zu sehen, ja sogar sich Gott als einen ritterlichen Gefolgsherrn vorzustellen, der nicht nur triuwe und staete besitzt, sondern edelkeit (462,23) und tugent (Wh 49,16)(133), êre (461,4; 485,28) und zuht (464,30; 148,26), der sogar vom ritterlichen Kampf etwas versteht (472,8).
Parzivals Antwort auf Herzloydes Lehre
Es wurde oben (vgl. S. 34) gesagt, dass die Lehre nur das entfaltet, was Gott im art des Menschen angelegt hat. Da der Mensch aber auf Gott hin geschaffen ist, liegt in diesem art verborgen auch die Erkenntnis Gottes (anima naturaliter christiana). Darum versteht Parzival Herzeloyde sogleich und sträubt sich nicht gegen ihre Lehre, während er ihrem Versuch, ihn gegen seinen art vom Rittertum fernzuhalten, notwendig widersteht. Das ôwê, das Parzival ausruft, als er zum ersten Mal den Namen Gottes hört, (51) charakterisiert das erschreckte und freudige Erstaunen dessen, dem das, was unbewusst schon in ihm lag, plötzlich beim Namen genannt, bewusst gemacht wird.
Parzival hat also sogleich verstanden, was Herzeloyde ihm gesagt hat, und kann darum nach der Belehrung schnell fortspringen und sich um die Jagd kümmern: Das Wissen um Gottes helfe ist ihm nun selbstverständlicher Besitz. Darum fällt er auch ohne Zögern vor den Rittern, die ihm begegnen und von denen er nicht wissen kann, dass sie Menschen sind, auf die Knie und bittet sie um Schutz und Hilfe:
hilf, got: du maht wol helfe hân (121,2) (134).
Dass Parzival Gott und Menschen verwechselt, sagt nichts gegen die Lehre Herzeloydes und nichts darüber, dass Parzival diese Lehre nicht aufgenommen habe (Vom „christlichen Gott . . . wusste er (Parzival) . . . gar nichts."(135)), sondern weist auf den kindlichen und darum unverschuldeten Unverstand (tumpheit) hin, der ihn später auch die ritterliche Lehre Herzeloydes so verfehlt befolgen lässt. Als Gurnemanz, in dessen Lehre der „Geist der christlichen Nächstenliebe . . . offen ausgesprochen wird"(136), Parzival von seiner tumpheit befreit (169,15-20), kann die Lehre Herzeloydes sich reich entfalten, und Parzival steht wie alle Ritter, deren Vorbild er dann geworden ist, in einem Verhältnis zu Gott, das vom Geist des Christentums, wie Wolfram es versteht, völlig erfüllt ist. Er weiß dann, dass er in Gottes triuwe geborgen ist und dass all sein Verdienst, seine werdekeit, aus der Kraft Gottes kommt. Als er auf der Gralsburg wegen seiner werdekeit gepriesen wird, antwortet er:
diu gotes kraft gît sölhen solt (228,24).
Die Christlichkeit des Artusrittertums
G. Weber hat gemeint, Wolfram habe durch das Scheitern Parzivals die Christlichkeit des hochmittelalterlichen Ritters kritisieren wollen. „Im Symbol Parzival hat die ritterliche Welt versagt„ (vgl. o. S. 30). H. Kolb sieht den Grund dieses Versagens im Mangel an christlicher Demut: „. . . Demut, die aus dem Bewusstsein eigener hôher art entspringt und die dieses adlige Selbstbewusstsein noch zu hoehen sich imstande zeigen soll, ist in der Wurzel verschieden von dem christlichen Begriff der Demut . . ."(137). Unter christlicher Demut versteht Kolb mit Bernhard von Clairvaux eine Demut, durch die der Mensch „verachtungswürdig vor sich selbst"(137)werde.
Nach dem bisher Dargestellten aber besteht kein Widerspruch zwischen „dem Bewusstsein eigener hôher art„ und christlicher Demut, da dieses Bewusstsein getragen ist von dem Wissen, dass auch die êre des Ritters Lohn (52) der Gnade Gottes ist. Zudem kann Wolfram, so wie er sich im Roman darstellt, vom Menschen zwar die Demut erwarten, die weiß, dass alle Kraft von Gott ist (380,12), aber nicht die Haltung, dass er sich selbst verachte.
An der Haltung der Artusritter und der Ritter, die nach den Idealen des Artusrittertums leben, kann gezeigt werden, dass ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eine Christlichkeit, die in ihrem Kern Demut ist, sich nicht ausschließen. Auf diese Weise kann das Argument entkräftet werden, die êre des Artusritters sei Zeichen sündhaften Weltwillens und Parzivals Weg ins Artusrittertum ein Weg in die Sünde.
Wie Parzival so wissen auch die übrigen Ritter des Romans, dass sie sich nur im Herrn rühmen können (1. Kor 3,31): Von Gawan berichtet der Erzähler, dass er Gott ie sîns prises jach (568,12); und auch der verarmte Ritter vor dem Wunderschloss weiß, dass alle tugent (559,5-8) und alle êre von Gott kommt:
und hât iuch got wol gêret (558,24).
Selbstverständlich besitzen die höfischen Ritter das Wissen, dass alles, was die êre des Ritters ausmacht, durch die gebe Gottes (561,20) bewirkt ist (138): der Besitz (Galoes will sein Hab und Gut mit seinem Bruder Gahmuret teilen, da Gott es ihm gegeben hat; 7,7-10), der
prîs (558,23/24; 568,12), die Kraft zur Hilfsbereitschaft (332,27-30), die Kraft zum Kampf (380, 12/13), die triuwe (415,29-416,4). Der Ritter weiß also, dass er nichts hat, was er nicht von Gott empfangen hat (1. Kor 4,7), dass auch die vröide des Lebens Geschenk der Gnade ist:
diu gotes kraft dir virre leit (124,21);(138a)
er weiß, dass er nicht tüchtig ist von sich selbst, sondern dass seine Tüchtigkeit von Gott kommt (2. Kor 3,4-6; vgl. o. S. 25-27).
So erfüllt Gott durch den Lohn der Gnade sein Bundesversprechen, und jeder Ritter weiß sich sicher geborgen in diesem Bund mit Gott, auch dann noch, wenn dieser ihm Leid schickt (561,28/29). Als Gawan(139) auf dem Bett des Wunderschlosses liegt und die âventiure erwartet, die ihn das Leben kosten kann, heißt es von ihm:
Er lac, unde liez es walten
den der helfe hât behalten,
und den der helfe nie verdrôz,
swer in sînem kumber grôz
helfe an in versuochen kan.
der wîse herzehafte man,
swâ dem kumber wirt bekant,
der rüefet an die hôhsten hant:
wan diu treit helfe rîche
und hilft ihm helfeclîche (568,1-10).(139a)
(53) Diese Worte vom Vertrauen auf die helfe Gottes spricht der Erzähler, und es ist nicht einzusehen, warum sich hinter ihnen „leichter Spott"(140)verbergen soll; sie erweisen, dass Wolfram sich mit der Christlichkeit seiner Artusritter identifiziert: wenn Wolfram als der Erzähler von Gott spricht, klingt es nicht anders, als wenn es die Artusritter tun. Vor allem Gawans Vertrauen in die gütige Lenkung jeden Geschicks durch Gott ist Wolframs eigenste Überzeugung (185,18; 200,16; 210,29; 396,19).
Gottes Güte und Liebe garantiert also den Artusrittern, dass er den Bund mit den Menschen nie brechen, dass er immer seine Hilfe gewähren wird. Die Artusritter leben also fraglos im Bund mit Gott und antworten auf seine triuwe mit ihrer triuwe. Diese triuwe umfasst alle Glieder dieses Bundes, also alle, die von der Liebe Gottes erreicht werden. Darum ist die Liebe zu Gott zugleich auch immer die Liebe zu seiner Schöpfung, ein amare mundum in Deo, und umgekehrt. „Amor Dei et invicem in Deo ist Augustins feste Formel für die unteilbare Einheit dieses Aktes."(141) Die Christlichkeit des mittelalterlichen Ritters erweist sich somit in seiner Liebe zu seinem Mitmenschen und ist an dieser Liebe nachprüfbar; die ethischen und religiösen Tugenden des Ritters können folglich nicht voneinander getrennt werden (vgl. o. S. 30 f.).
Zeugnis dieser Liebe sind Hilfsbereitschaft und Mitleid. Diese Haltung ist aber für die Ritter in Wolframs Roman so selbstverständlich, dass die Aufforderung zu Hilfsbereitschaft und Mitleid zum Abschiedsgruß geworden ist:
got lêre iuch helfe und kumbers klage (648,30). (141a)
Mitleid hat z. B. Orgeluse, die zum Artuskreis gehört, mit den Leiden des Anfortas:
glîchen jâmer oder mêr,
als Cidegast geben kunde, (141b)
gab mir Anfortases wunde (616,24-26).
An den Freudentränen, die Orgeluse weint, als Anfortas erlöst wird, wird die Tiefe dieses Mitleids offenbar:
Orgelûs durh liebe weinde,
daz diu vrâg von Parzivâle
die Anfortases quâle
solde machen wendec (784,4-7).(141c)
Wie sehr Wolfram die Artusritter als die Frucht des Lichtes sieht, die in lauter Güte (bonitas), Gerechtigkeit und Wahrheit (vgl. o. S. 45) besteht, zeigt er an der Gestalt des Königs Artus, von dem Hartmann sagt, dass er das Vorbild rehter güete (‚Iwein’ 1,1) gewesen sei. Artus' triuwe (307,16; 310,8) umfasst sogar den Feind: er vergibt die laster (220,15) Clamides:
Artûs vil getriwer munt
verkôs die schulde sâ zestunt (220,23/24); (141d)
(54) und auch Ginover kennt diese verzeihende Liebe, als sie mit triwen Parzival den Tod Ithers vergibt:
,nu verkiuse ich hie mit triwen',
sprach si, ,daz ir mich mit riwen (141e)
liezt ... (310,27-29).
Nach Wolframs Vorstellung schließen sich also die Gesittung des hochhöfischen Ritters und christliches Ethos nicht aus. Vielmehr ist für ihn die ritterliche Gesittung so sehr vom christlichen Geist erfüllt, dass er ‘ritterlich’ und ‘christlich’ identisch setzt und darum in seinem Roman unchristlich nur der Nicht-Ritter ist; Einzig der vilân ist aller güete laere (142,18), nur er stellt sich außerhalb der durch triuwe bestimmten Gemeinschaft und kümmert sich um niemanden als um sich selbst (142,26).
Die Welt der Artusritter, in der Parzival Aufnahme findet, ist also in Wolframs Augen nicht überholt, entartet, in toten Regeln erstarrt oder gar verdammt, sondern sie ist eine erlöste und somit geheiligte Welt, in der ständig die Gnade Gottes wirkt. Die Artuswelt bleibt gültig und braucht nicht überwunden zu werden; sie kann sich darum am Ende des Romans in einem glänzenden Fest selbst bestätigen.
Von diesem Ergebnis her wird verständlich, dass Ritter, die typische Vertreter des höfischen Rittertums sind, auch von jenen gelobt werden, die nach Ansicht der Forscher, die das Artusrittertum kritisieren, die ‘wahre’ Christlichkeit vertreten: von Cundrie und Trevrizent. Ither, von dem Parzival das von J. Bumke so genannte ‘sündige Ither-Schwert’ (142) hat, wird von Trevrizent gepriesen:
der rehten werdekeit geniez,
des diu werlt was gereinet,
het got an im erscheinet (475,28-30). (142a)
Und würde Cundrie wirklich, wie G. Weber meint, in Parzival die ganze ritterliche Welt verfluchen, so wäre nicht verständlich, dass sie Ither als Gegenbild Parzivals feiert:
unglîch ir zweier leben was;
wan munt von rîter nie gelas,
der pflaeg sô ganzer werdekeit (315,13-15) (142b)
und dass sie Feirefiz' manheit (317,6) und Gahmurets triuwe, Lebensfreude und Tapferkeit rühmt (317,22-30).
Parzivals ‚zuht’ und ,triuwe’
Parzivals Versagen kann also nicht aus einer fehlgeleiteten Religiosität des höfischen Rittertums erklärt werden: Wolfram hat nichts an der Christlichkeit des höfischen Ritters auszusetzen, und Parzival erweist sich aufgrund seiner Religiosität als würdiger Vertreter dieses Rittertums, wie oben am (55) Beispiel seines Glaubens gezeigt wurde (vgl. o. S. 51). Der Nachweis, dass Parzival nicht nur die Lehre der Mutter gut verstanden hat, sondern dass sich seine Christlichkeit wie die der Artusritter auch darin bewährt, dass er in triuwe zu allen steht, die als Glieder des von Gott gestifteten Bundes auf diese triuwe, auf helfe und erberme Anspruch haben, wird dadurch erschwert, dass ihm von Sigune (255,14-16), Cundrie (314,30; 316,2; 316,18/19; 318,1) und Trevrizent (488,28) die triuwe abgesprochen wird:
daz groezer valsch (143) nie wart bereit
necheinem alsô schoenem man (316,18/19).(143a)
Die Forschung hat zum Teil diese Vorwürfe bereitwillig aufgegriffen: Parzival habe „das christliche Gebot der misericordia proximi mit der ritterlichen Haltung nicht vereinen" (144) können.
Mit Recht umschreibt man mit ,ritterlicher Haltung’ das, was Wolfram unter zuht versteht; denn diese Haltung ist vornehmlich durch Erziehung und durch die Ideale, auf die hin erzogen wird, also durch zuht bestimmt (vgl. o. S. 33). Und so glaubt man, eine Erklärung für den Satz durch zuht in vrâgens doch verdrôz (239,10) gefunden zu haben: Weil die zuht ohne erberme, das vornehmste Zeichen der triuwe, gewesen sei, habe sie scheitern müssen. So schreibt G. Weber, dass die zuht „höhere sittliche Werte, die triuwe und erbermde, verdunkelt"(145). Als Beleg für seine Auffassung gelten ihm Trevrizents Worte:
Swâ werc verwurkent sînen gruoz,
daz gotheit sich schamen muoz,
wem lât den menschlichiu zuht?
war hât diu arme sêle fluht? (467,1-4) (145a).
Hier spreche Trevrizent von der „Nutzlosigkeit aller menschlichen Erziehungswerte, wenn ihrer ungeachtet die Seele Schaden leidet" (146).
Ich kann in diesen Versen keinen Gegensatz von zuht und christlicher Haltung erkennen. Die ersten beiden Verse sprechen von dem Sünder, der Gott beleidigt hat; die beiden nächsten sind rhetorische Fragen, denn Trevrizent weiß auf eine Frage, was mit einem solchen Sünder geschieht, selbstverständlich eine Antwort: die menschlichiu zuht gibt einen solchen Sünder niemandem zur Obhut, und die arme sêle des Sünders hat keinen Ort, an den sie fliehen könnte. Das heißt aber: die zuht schließt den Sünder aus der Gemeinschaft derer, die nach ihr leben, aus, sie lässt nicht zu, dass der Sünder in der menschlichen Gesellschaft Zuflucht findet. Für Trevrizent schließen sich also zuht und Heil der Seele nicht aus, sondern entsprechen sich.
Ein weiterer Hinweis, dass Webers Entgegensetzung von zuht und triuwe nicht dem Text entspricht: Die Untersuchungen über die Christlichkeit der vom Ideal des Artusrittertums geprägten Ritter hat erwiesen, dass die durch (56) jene Ritter repräsentierte Gesellschaft, deren Wertvorstellungen unter dem Begriff zuht zusammengefasst werden können, nicht ohne die triuwe lebt, dass also Webers Entgegensetzung von zuht und triuwe nicht begründet ist. Demnach können auch die Wendungen valsch geselleclîcher muot (2,17) und valschlîch geselleschaft (782,26) nicht bedeuten, dass die ritterliche Gesellschaft zur Zeit Wolframs valsch, also ohne triuwe sei, wie Weber meint. geselleschaft ist kein soziologischer Begriff, sondern eine Bezeichnung für die Gemeinschaft zwischen zwei oder mehreren Menschen(147); geselleclîcher muot bedeutet also soviel wie friundes muot (148), und gesellekeit geloben (308,27-29) ähnliches wie den Treueeid schwören. Wolfram spricht also mit den Wendungen valsch geselleclîcher muot und valschlîch geselleschaft nicht dem ritterlichen Stand oder einer einzelnen Gestalt seiner Dichtung die triuwe ab, sondern warnt ganz allgemein vor valsch und untriuwe, warnt vor einer Pervertierung des geselleclîchen muots, wie er sie z. B. bei Gottfrieds Tristan finden konnte.
Wolframs Ritter, deren Haltung durch die zuht bestimmt ist, besitzen also, wie ihr Verhältnis zum Mitmenschen erweist, die triuwe; das heißt: zuht und triuwe schließen sich nicht aus. Die Interpretation, Parzival sei ohne triuwe gewesen, kann also nicht ohne weiteres von dem Vers durch zuht in vrâgens doch yerdrôz ausgehen. Im Gegenteil: Trevrizents Worte über das Verhältnis menschlîchiu zuht und Sünde (vgl. o. S. 55) lassen sogar vermuten, dass sich
zuht und triuwe nicht nur nicht ausschließen, sondern dass sie sogar in enger Beziehung zueinander stehen.
Kern der ritterlichen Ethik ist, wie oben gezeigt wurde, die triuwe: die Haltung, die in dem Gefühl der Solidarität aller Glieder der Gefolgschaft Gottes gründet. Wenn für Wolfram, anders als die oben zitierten Interpreten meinen, die zuht nicht einen Wertekanon umfasst, der sich von der triuwe gelöst und sich in einer erstarrten Ordnung verselbständigt hat, wenn Wolfram vielmehr in dieser zuht die Konkretisierung der mit triuwe bezeichneten Haltung, in ihr also die triuwe wirksam sieht, so müssen zuht und triuwe austauschbare Begriffe sein. Dass für Wolfram tatsächlich zuht und triuwe nahezu identisch sind, wird am deutlichsten dort, wo Trevrizent von der Menschwerdung Gottes spricht. Dieses Ereignis gilt im Neuen Testament als die Offenbarung der Güte (benignitas)
und Menschenfreundlichkeit
(humanitas),
des Erbarmens
(miseriocordia)
und der Liebe Gottes (149). Trevrizent kennzeichnet diese einzigartige Tat der Liebe in dem Satz:
daz was sînr hôhen art ein zuht (464,30).
An anderer Stelle wird im Zusammenhang mit der Menschwerdung gesagt, dass Gott
ein triuwe (462,19) sei, und die Äußerung dieser triuwe wird erbarme (465,8) genannt. An Christus ist also Gottes triwe erkennet (752,30; vgl. 113,22). Der Vergleich von Vers 464,30 mit den übrigen zitierten Aussagen über die Menschwerdung lässt also den Schluss zu, dass (57) Wolfram mit zuht und triuwe dieselbe Haltung bezeichnet, dass zuht also ebenso wie triuwe durch Barmherzigkeit (150), Menschenfreundlichkeit, Güte, Liebe übersetzt werden kann.
Aufgrund dieser Untersuchung über das Verhältnis von
zuht und triuwe kann über die Funktion der zuht innerhalb der Wertvorstellungen Wolframs gesagt werden, dass zuht bei Wolfram als zusammenfassender Begriff für alle Einzelwerte und Einzelvorschriften erscheint, die in der triuwe ihren „lebendigen Quellgrund"(151)haben, so dass jeder einzelne Wert wie die Summe aller Werte, die zuht, in einem „Variationsverhältnis"(152) zur triuwe (153) stehen.
Von dieser Interpretation her kann nun auch der Satz durch zuht in vrâgens doch verdrôz gedeutet werden: Es ist die triuwe und erberme, die ihn zu fragen hindert, und nicht knechtische Furcht vor dem Gesetz, wie W. J. Schröder meint, oder das Festhalten an einer „dünnen konventionellen Schablone"(154), wie Weber formuliert. Parzivals Klage:
Sol ich durch mîner zuht gebot
hoeren nu der werke spot,
so mac sîn râten niht sin ganz:
mir riet der werde Gurnamanz
daz ich vrävellîche vrâge mite
und immer gein unfuoge strite (330,1-6) (154a)
kann darum nicht als grundsätzliche Verurteilung der zuht gedeutet werden, wie Weber es versucht, sondern muss verstanden werden als Ausdruck von Parzivals Verzweiflung darüber, dass er, der sich, gemessen am Maß ritterlicher Ethik, nichts hat zuschulden kommen lassen, durch die Verfluchung Cundries die êre verliert, dass er durch t r i u w e im Leid lebt (467,18). Aus Parzivals Worten: ,dass ich dreistes, unpassendes Benehmen vermieden habe, muss wohl falsch gewesen sein’ spricht die bittere Ironie des Verzweifelten (155); nicht aber wird in ihnen die zuht abgewertet.
zuht ist also bei Wolfram als Ausdruck der triuwe zu verstehen. Diese Interpretation macht zwar den Vorwurf Cundries, Trevrizents und Sigunes, Parzival habe die triuwe gefehlt, noch unverständlicher, doch passt sie in das Bild, das Wolfram von Parzival gezeichnet hat.
Parzival selbst interpretiert sein Versagen auf der Gralsburg nicht als Verfehlung, sondern glaubt, dass er, als er durch zuht nicht fragte, durch triuwe (467,18) gehandelt habe, sein Leid also eine Folge seiner triuwe sei. Damit diese Auslegung nicht als Verstocktheit missverstanden werden kann, bestätigt der Erzähler sie nachdrücklich: Als Parzival die Gralsburg verlässt, nennt er ihn sehr betont valscheite widersaz (249,1); als Parzival in den Anblick der drei Blutstropfen versunken ist, wird er vom Erzähler valscheitswant (296,1) (155a)
genannt und schließlich gegen die Verfluchung durch Cundrie in Schutz genommen:
den rehten valsch het er vermiten (319,8).
(58) Die Interpretation, die den Aussagen des Erzählers folgt, muss den Vorwurf, Parzival habe die triuwe gefehlt, zurückweisen, denn nach den Worten des Erzählers hat Parzival immer die triuwe besessen, also auch dann, als er auf der Gralsburg nicht fragte. So heißt es von Parzival:
sîn herze valsch nie underswanc (678,23) (155b)und von Parzival und Gawan:
gein ein ander stuont ir triwe,
der enweder alt noch niwe
dürkel scharten nie enpfienc (680,7-9).(155c)
Eindringlicher noch als diese Aussagen des Erzählers aber bestätigt der Handlungsverlauf, dass in der ritterlichen zuht Parzivals die triuwe wirkt, die sich nach christlicher Vorstellung vor allem als Mitleid und Erbarmen mit dem Nächsten, also als Nächstenliebe zeigt.
Schon als Kind ist Parzival voller Mitleid, als er den Tod der Vögel betrauert; Mitleid hat der junge Parzival mit Sigune (140,1/2; 141,25/26), als er ihr zum ersten Mal begegnet; er zeigt Mitleid bei Cunneware und Antanor (153,17; 158,27-159,2). Doch Parzival hat nicht nur von Natur (art) ein mitleidiges Herz (156), er ist auch mitleidig durch zuht, so dass nicht gesagt werden kann, die zuht, die dann als ein lebloses, starres Gefüge von Regeln und Geboten verstanden wird, hindere ihn, auf die „Stimme des Herzens"(157) zu hören. Vielmehr entfaltet die zuht das, was im art schon angelegt ist (vgl. o. S. 34), so dass Parzival auch Erbarmen und Mitleid zeigt, nachdem er von Gurnemanz über die zuht belehrt ist: Er empfindet so sehr das Leid des Gurnemanz (der gast nams wirtes jâmer war; 178,27), dass er verspricht zurückzukommen, um seinem väterlichen Erzieher die Freude zu bringen (178,29-179,6). De Boor dagegen glaubt, die Erziehung durch Gurnemanz habe Parzivals Anlage zum Mitleid verkümmern lassen: „. . . Gurnemanz’ Leid um seine drei Söhne . . . vermag Parzival (nicht) innerlich nachlebend zu erfassen . . . Diese Unfähigkeit, sich anderen und ihrem Leid zu öffnen, deutet auf den entscheidenden Augenblick vor: das Unterlassen der Mitleidsfrage in der Gralsburg."(158)Dass Parzival nicht das Leid des Gurnemanz lindert, da er Liaze nicht heiratet und so dem Vater die gefallenen Söhne nicht ersetzt, hat seinen Grund nicht in einem Mangel an triuwe: Es ist für Wolfram undenkbar, dass ein Ritter den Fehler Erecs begeht und sich verliget (vgl. 2,15); zunächst muss er in die Welt und im strît seine Tauglichkeit erproben. Erst wenn sich seine zuht bewährt hat, ist er berechtigt und fähig, sich für immer mit einem anderen Menschen zu verbinden, und erst dann wird diese Bindung die der triuwe sein. Und so heißt Wolfram den Aufbruch Parzivals uneingeschränkt gut (176,30-177,8).
Der Abschied von Gurnemanz geschieht also unter den gleichen Bedingungen wie der Abschied von der Mutter: Parzival tut, was er tun muss; dass er (59) dabei Leid bewirkt, beweist nicht einen Mangel an triuwe und ist ihm nicht als Schuld zuzurechnen. Denn als er Gurnemanz verlässt, glaubt er, er könne dessen Leid noch heilen. Doch da nicht Liaze, sondern Condwiramurs ihm zur Frau bestimmt ist, kann er Gurnemanz nicht helfen; sein Geschick, aber nicht fehlendes Mitleid, hindert ihn, zu Gurnemanz zurückzukehren, so wie es ihn auch hindert, seine Mutter aufzusuchen und ihr beizustehen.
Auch weiterhin hat der Held Gelegenheit genug, Mitleid und tätiges Erbarmen zu erweisen: Die Befreiung Pelrapeires ist eine Tat des Erbarmens (185,16); bei der Verteilung der Nahrung denkt er zunächst an die anderen und zuletzt an sich (191,1-5); dass Parzival Clamide nicht tötet, wird erbärme genannt (214,2); es ist Parzival leit (215,9), dass Cunneware geschlagen wurde, und er stellt ihr Ansehen wieder her, ebenfalls das Jeschutes, mit der er Mitleid hat (255,23); als er sich allein in der Gralsburg findet, glaubt er, Anfortas sei in den Krieg gezogen, und will ihm und Repanse de Schoye mit triuwen (246,13) beistehen, und er folgt der Spur der Gralsritter, nicht aus Neugierde wie Perceval, sondern um ihnen zu helfen (248,19-30). Dann begegnet er wieder Sigune und ist - anders als Perceval - voller Mitleid:
frouwe, mir ist vil leit
iwer senelîchiu arebeit (249,27/28), (158a)
und Sigune dankt ihm:
got lôn dir daz dich dô sô rou
mîn friwent, der mir zer tjost lac tôt (252,18/19).(158b)
Als er hört, dass Anfortas seinetwegen unerlöst bleibt, tut ihm dies bitter leid (256,1-4), nicht seinetwegen, sondern um der Leiden des Anfortas willen.
Nicht nur die Definition von zuht als Ausdruck der triuwe, auch die Fülle der Belege für Parzivals triuwe machen es unwahrscheinlich, dass Parzival, als er durch zuht die Frage unterließ, nicht aus triuwe heraus gehandelt hat, dass „nicht das Geschehen um den anderen, den leidenden Mitmenschen (Parzival) beherrscht . . ., sondern das mögliche Geschehen um ihn selbst"(159), wie G. Weber meint. „Es wäre auch in der Tat verwunderlich genug, wenn Wolfram, dem offensichtlich seit Beginn des Werkes daran gelegen war, Parzival als im Besitze eben der Tugend der Barmherzigkeit zu zeigen, seinem am Gralshofe auftretenden Helden diese Tugend plötzlich entzogen hätte, nur um sie unmittelbar nach Parzivals Wegritt aus Munsalvaesche erneut in strahlendem Licht aufleuchten zu lassen."(160)
Die Darstellung Wolframs weist also darauf hin, dass Parzivals Verhalten am Gralshof von der triuwe geleitet war. Bestehen bleibt aber bei aller Eindeutigkeit der Belege der Widerspruch zwischen diesem Interpretationsergebnis und dem Vorwurf Sigunes, Cundries und Trevrizents, Parzival (60) sei ohne triuwe gewesen, als er nicht gefragt hatte. Die Lösung dieses Widerspruchs wird zu einer Interpretation der Gralsfrage führen, die sich von den bisherigen Interpretationen wird lösen müssen (vgl. 4. Kap.).
Herzeloydes Ritterlehre
Parzivals reiner süezer hôher art (164,15) ist durch Erziehung in angemessener Weise entfaltet: Parzivals Christlichkeit entspricht wie die der Artusritter durch das Vertrauen auf Gottes
helfe und durch Äußerungen der triuwe den Idealvorstellungen Wolframs.
Ineins damit ist aber auch über die andere, die weltliche Seite des ritterlichen Lebens Parzivals schon ein Urteil gefällt; denn bei Wolfram stehen christliches und ritterlich-weltliches Leben nicht neben- oder gar gegeneinander, sondern dieses gründet in jenem, die ritterliche zuht lebt aus der triuwe.
Eine Untersuchung der Belehrungen, die Parzival von Herzeloyde und Gurnemanz über das rechte Verhalten in der ritterlichen Welt erhält, soll im einzelnen nachweisen, dass die ritterliche Tugendlehre in Übereinstimmung steht mit der christlichen Grundhaltung der triuwe und dass darum auch in Parzivals Erziehung zum ‚diesseitsfrohen’ Ritter nicht die Erklärung für Parzivals Versagen gefunden werden kann.
Gegen Herzeloydes zweite Belehrung sind wie gegen ihre Gotteslehre viele Einwände erhoben worden. Sie gründen vor allem darauf, dass die Erziehung durch Herzeloyde zunächst keinen Erfolg hat, dass sie nicht so gelingt wie etwa die Tristans durch Curvenal (144,20), dass also Parzival die
kurtôsîe fehlt (144,21), so dass er, obwohl er, durch den
art bestimmt, es recht machen will und recht zu machen glaubt, so lächerlich, so kläglich und so unheilvoll in die Irre geht. Zunächst könnte man vermuten, Herzeloyde habe ihrem Sohn, so wie sie ihn in ein Torengewand gekleidet hat, damit er, von der Welt verlacht, bald zu ihr zurückkehre, mit der gleichen Absicht auch falsche oder bewusst unvollständige Lehren auf den Weg gegeben. Doch das Hauptargument, das für eine solche Vermutung zu sprechen scheint, kann gegen sie verwendet werden: Herzeloydes Lehre müsse unvollständig, mangelhaft, könne nicht eine Lehre der
zuht sein, da Herzeloyde ja selbst auf einen
grâ wîsen man (127,21) weist, der Parzival die zuht lehren solle. Wenn sie ihren Sohn aber an einen solchen erfahrenen Menschen weist, so kann sie an eine Rückkehr Parzivals im Grunde nicht mehr geglaubt haben (vgl. o. S. 43 f.), und so wird auch ihre Erziehung - trotz der unhöfischen Kleidung und der unritterlichen Bewaffnung - die Absicht haben, dass Parzival in der Welt d. h. aber in der Welt des höfischen Ritters, sich zurechtfindet. Selbstverständlich gehört zu einer solchen (61) Erziehung auch der rât, der Jüngere soll auf den Älteren, Erfahrenen hören, nicht um Falsches zurechtzurücken oder Mangelhaftes zu ergänzen, sondern um die höfische zuht zu erweitern, weiter zu pflegen und zu bilden.
Der moderne Leser könnte Anstoß daran nehmen, dass die Mutter zur Belehrung Parzivals nur eine Nacht Zeit hatte und dass diese Zeit zur Erziehung allzu kurz sei. Er könnte folgern, Herzeloyde wisse das auch und erwarte, dass Parzival mit ihren Lehren nicht viel anfangen könne, sie missverstehen müsse, und darum schicke sie ihn zu einem erfahrenen Mann, damit er dort zuht lerne. Solche Überlegung, die sich auf den Realismus in der Darstellungsweise des Dichters beruft - in diesem Fall auf psychologische Wahrscheinlichkeit -, geht am Roman vorbei. Für Wolfram ist nicht die psychologische Wahrscheinlichkeit das wichtigste: wichtiger sind ihm die Grundideen, die er ohne Rücksicht auf psychologische Wahrscheinlichkeit darstellt. An dieser Stelle will Wolfram zeigen, dass die zuht im art liegt (zuht von arde), so dass es nur eines Anstoßes bedarf, damit sie sich voll entfalten kann: darum ist Parzival bei Gurnemanz schon am ersten Tag zum vollkommenen Ritter erzogen; irgendwelcher Übung und Gewohnheit bedarf es nicht. Die weiteren dreizehn Tage, die Parzival bei Gurnemanz bleibt, würden, vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeit aus betrachtet, ebenfalls nicht ausreichen, um aus einem Toren einen vollkommen gebildeten Menschen zu machen. Da es also nicht um psychologische Wahrscheinlichkeit in der Darstellung geht, ist die Kürze der Erziehung durch Herzeloyde kein Erweis eines Mangels, aufgrund dessen Parzival scheitern müsste. Und wäre Parzival nicht ein Tor, so hätte er trotz der ‚unwahrscheinlich’ kurzen Zeit der Erziehung den rât der Mutter, auch den, auf erfahrene Menschen zu hören, sofort richtig befolgen können und nicht so tölpelhaft, wie es tatsächlich geschieht.
Auch ist das Versagen Parzivals nicht durch das Argument erklärt, Herzeloyde könne Parzival nicht vollständig erzogen haben, da sie eine Frau sei; denn zur Erziehung des Ritters gehöre notwendig auch die Belehrung über das Waffenhandwerk. Unzutreffend ist dieses Argument, da für Wolfram die Belehrung über den rechten Umgang mit Pferd und Waffen zwar notwendig, aber nicht wesentlich ist. Wesentlich ist für ihn die Erziehung zur rechten ethischen Haltung. Als z. B. der Vater des Meljanz den Fürsten Lyppaut bittet, seinen Sohn zu erziehen, spricht er ausschließlich von der Achtung und dem Erbarmen, das der Ritter seinen Mitmenschen schuldet (385,8-11); und von der Erziehung Gahmurets ist für Wolfram nur der Teil erwähnenswert, den Ampflise beigetragen hat (94,21-26; 325,27-29). Dass Gahmuret auch lernen musste, mit Pferd und Waffen umzugehen, ist für Wolfram zweitrangig trotz des Vergnügens, mit dem er Kämpfe schildert.
Dass die Mutter mit Absicht zu lehren unterlassen hatte, wie ein Ritter sachgemäß zu kämpfen und sich modisch zu kleiden hat, kann für Wolfram (62) also kein wesentlicher Mangel der Erziehung sein. Darum lässt er den Helden nicht deswegen scheitern, weil er nicht recht zu tjostieren versteht oder weil er unhöfisch gekleidet ist, sondern weil ihm die Einsicht in das ritterliche Ethos fehlt, über das die Mutter ihn belehrt hatte und durch das das Waffenhandwerk erst zum Ausdruck ritterlicher Haltung wird. Wäre Parzivals Verstand erleuchtet gewesen, so dass er die Ermahnungen der Mutter recht verstanden hätte, so hätte er leicht sich die äußere Haltung des Ritters aneignen können, spätestens dann, nachdem er am Artushof war und Iwanet ihn sogar auf das Unmögliche seines Aufzugs hingewiesen hatte. Das, was Herzeloyde mit Absicht versäumt hatte, hätte so schnell und so leicht nachgeholt werden können, dass von daher kein Grund für Parzivals Scheitern gegeben ist.
Noch eine weitere Beobachtung spricht dafür, dass Herzeloydes Lehre nicht unzureichend war: Denn wäre irgend etwas an Herzeloydes Worten falsch - das gilt für die Gotteslehre ebenso wie für die höfische Lehre -, so müsste diese Lehre später aufgehoben werden. Dass dies auch tatsächlich geschehe, behauptet W. J. Schröder: die Lehre der Mutter müsse abgelöst werden durch die des Gurnemanz, da sie eine Stufe der Heilsgeschichte repräsentiere, die keine Gültigkeit mehr haben könne: „Parzival gibt das Wissen, das er von der Mutter hat, zugunsten eines neuen, höheren Wissens auf."(161) Schröder zitiert dazu die Verse:
ir redet als ein kindelîn.
wan geswîgt ir iwerr muoter gar?
und nemet anderr maere war (170,10-12).
Tatsächlich aber ist es auch weiterhin nicht Parzivals Absicht, die Mutter und ihre Worte zu vergessen. Gurnemanz meint zwar, Parzival dürfe sich nicht fortwährend auf seine Mutter berufen; bei einem erwachsenen Menschen sei dies lächerlich und kindisch(162). Statt dessen solle Parzival auf das hören, was er, sein neuer Lehrer, ihm raten wolle; denn man müsse auch noch(163) offen sein für das, was andere zu sagen haben (anderr maere - die maere anderer Leute). Nicht ist mit dieser Ermahnung gemeint, Parzival solle das Wissen, das er von der Mutter hat, aufgeben. Und Parzival hört auf das, was Gurnemanz ihm rät:
sîner muoter er gesweic,
mit rede, und in dem herzen niht (173,8/9).
Unter rede ist hier das laut geäußerte Wort zu verstehen: Parzival redet nun nicht mehr zuviel, plappert nicht mehr kindisch alles aus, was er weiß und fühlt. Doch ist die Lehre der Mutter in sein Herz geschrieben, wie sein Gewissen bezeugt. Dass Parzival nicht nur ganz allgemein die Gestalt der Mutter im Herzen hat, sondern auch ihre Worte, dass also auch der rât der Mutter in seinem Gewissen spricht und dass dieser rât gleichwertig neben (63) dem des Gurnemanz steht, ist in der Dichtung belegt. Als Parzival sich mit Condwiramurs vereint, heißt es:
von im dicke wart gedâht
umbevâhens, daz sîn muoter riet:
Gurnemanz im ouch underschiet,
man und wîp waern al ein (203,2-5).(163a)
Weil aber Parzival hier die Lehre in rechter Weise befolgt, kann auch nicht gesagt werden, Herzeloyde habe sich missverständlich ausgedrückt, deshalb habe Parzival sie missverstehen müssen. Zwar hat Wolfram die Lehren so formuliert, dass ein falsches Verständnis durch Parzival nicht ausgeschlossen ist, doch soll diese ‚Unklarheit’ der Formulierung nicht einen Mangel der Belehrung kennzeichnen, sondern den Unverstand des Belehrten.
Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. An sich richtig wie jede der fünf Ermahnungen ist auch die über das Verhältnis zur Frau:
swâ du guotes wîbes vingerlîn
mügest erwerben unt ir gruoz,
daz nim: ez tuot dir kumbers buoz.
du solt zir kusse gâhen
und ir lîp vast umbevâhen:
daz gît gelücke und hohen muot,
op sie kiusche ist unde guot (127,26-128,2).(163b)
Der Zuhörer Wolframs weiß, was gemeint ist: dass die Gunst der Frau Krönung des ritterlichen Lebens (164), dass sie der Erweis von Vollendung und Reife ist, dass aber ein solches Verhältnis zur Frau nur in der Ehe denkbar ist, wo minne und triuwe zwischen Mann und Frau ihren rechten Ort haben(165) 165a); denn in der Ehe erweist der ganze Mensch in gleicher Weise mit Leib und Seele dem Anderen seine Zugehörigkeit, weiß sich ihm für immer verbunden.
Dass Herzeloyde von Umarmung und Ring spricht und nicht minne und Ehe nennt, kann durch eine poetologische Überlegung erklärt werden. Man wird keine Dichtung finden, auch in der Zeit des Naturalismus nicht, die unverkürzt die Wirklichkeit wiedergibt. Der Dichter kann nur Ausschnitte der Wirklichkeit beschreiben. Diese Ausschnitte aber müssen so gewählt sein, dass sie charakteristisch sind für das Ganze dieser Wirklichkeit (vgl. o. S. 45 f.). Der Epiker hat aber leicht die Möglichkeit, diese Verfahrensweise deutlich zu machen, indem er selbst in wenigen Worten den ganzen Komplex, den er im Symbol dargestellt hat, zusammenfasst; so geschieht es etwa als Abschluss der Gotteslehre Herzeloydes:
sîn muoter underschiet im gar
daz vinster unt daz lieht gevar (119,29/30; vgl. o. S. 45).
(64) Auch bei Herzeloydes Ritterlehre gibt es eine solche Bemerkung: Herzeloyde bittet ihren Sohn, er möge noch eine Nacht bleiben, da sie ihn noch list ... lêren (127,11-14) möchte. Sie wird ihm in dieser Nacht in aller Ausführlichkeit die Werte des höfischen Lebens ans Herz gelegt haben; der Dichter teilt davon nur eine exemplarische Auswahl mit. Zugleich aber ermöglicht diese verkürzte Formulierung das Missverständnis Parzivals; es kann mit ihrer Hilfe dargestellt werden, wie eine an sich richtige Lehre durch kindlich-törichtes Denken entstellt wird.
An den Worten Herzeloydes erweist sich also nicht deren törichtes Verhalten, sondern der Humor, die Ironie und ein geschickter Kunstgriff des Epikers Wolfram, der das Exemplarische so ausgewählt hat, dass es nicht nur, symbolisch verkürzt, das Ganze einer christlich-ritterlichen Unterweisung andeutet, sondern auch, indem es allzu wörtlich genommen und befolgt wird, geeignet ist, den Unverstand Parzivals anschaulich zu machen und zugleich den Fortlauf der Handlung zu motivieren.
Die Begründung, die Lehre der Mutter sei mangelhaft, weil der Erzähler nur die Worte von Ring, Gruß, Umarmung und Kuss mitteilt und nicht ausdrücklich minne und Ehe erwähnt, ist also unzureichend: das verständige Publikum Wolframs weiß, dass nur Ehe und minne gemeint sein können(166), und es weiß zugleich, dass Parzival unverständig ist, wenn er dies nicht begreift. Dass die Mutter mit ihrer Lehre über das Verhältnis zur Frau tatsächlich die Ehe gemeint hat und dass Parzival mit klarem Verstand dies auch hätte begreifen können, wird deutlich, als er diesen
rât später in rechter Weise anwendet: in der Ehe mit Condwiramurs.
Auch die übrigen Ermahnungen der Mutter sind so formuliert, dass sie sowohl Wesentliches über die höfisch-ritterliche zuht mitteilen als auch die Handlung, durch die Parzivals tumpheit sichtbar wird, motivieren. Wenn also Parzival von der Mutter hört:
der stolze küene Lähelîn
dînen fürsten ab ervaht zwei lant,
diu solten dienen dîner hant,
Wâleis und Norgâls.
ein dîn fürste Turkentâls
den tôt von sîner hende enphienc:
dîn volc er sluoc unde vienc (128,4-10), (166a)
so wird diese Nachricht zunächst zu einem der Motive für den unseligen Brudermord an Ither (154,25); zum anderen erfährt er von seiner Verantwortlichkeit für sein Land und sein Volk, für das er sich wehrhaft einzusetzen hat.
Vollständig ist - bei der Einheit von religiösen und sittlichen Tugenden - die ritterliche Unterweisung der Mutter erst, wenn sie mit der religiösen zusammengesehen wird. Darum knüpft die erste Ermahnung (65) Herzeloydes an ihre Gotteslehre an: ihrer Warnung vor der helle wirt (119,25) entspricht die vor den ungebanten strâzen:
an ungebanten strâzen
soltu tunkel fürte lâzen:
die sîhte und lûter sîn,
dâ solte al balde rîten în (127,15-18; vgl. 303,3/4).
Auch diese Ermahnung lässt durch ihre Formulierung die beiden Möglichkeiten offen, dass Wolframs Publikum ihren Sinn begreift, Parzival ihn aber missversteht. Die Mutter warnt ihren Sohn ganz allgemein vor den Gefahren, die ihm in der Welt begegnen werden, vor dem Herrn der Finsternis, dessen dunkle Wege er meiden soll; sie rät ihm, einen Weg zu gehen, von dem er weiß, dass das Böse auf ihm keinen Hinterhalt gelegt hat, und sich nur dort hinzuwenden, wo die Verhältnisse durchsichtig und rein sind, so dass er keinen Fehltritt begehen kann. Den Fehltritt aber vermeidet er nur, wenn er mit einem durch Gottes durchliuhtec lieht (466,3) erleuchteten Verstand den Dingen gegenübertritt.
Als Parzival Gurnemanz verlässt, heißt es von ihm:
ritters site und ritters mâl
sîn lîp mit zühten fuorte (179,14/15): (166b)
Wie es der zuht entspricht, besaß Parzival art und Haltung eines ritters, denn site bezeichnet das Verhalten, das Ethos des ritters, wie es am Leitbild der zuht gebildet ist. Aber nicht erst von Gurnemanz hört Parzival, wie Ritter sich verhalten sollen, schon Herzeloyde belehrt ihn über den site.
du solt dich site nieten (127,19); (166c)
und sie exemplifiziert diese Mahnung am einzelnen Fall, der aber wesentliche Bedeutung hat:
der werlde grüezen bieten (127,20).
Sie verlangt von ihm die zuvorkommende höfliche Geste den Mitmenschen gegenüber, die als Zeichen der Menschenfreundlichkeit und Geselligkeit wesentlich zur höfischen zuht dazugehört, denn die gepflegte Umgangsform, die vornehme, schöne Gebärde sind in hochhöfischer Zeit nicht nichtssagende Floskeln, sondern der adäquate Ausdruck einer vonehm-edlen Gesinnung, die durch die triuwe bestimmt ist. Eine innere Verfassung, die sich nicht nach außen hin in höfisch-schöner Form zeigt, ist gar nicht vorhanden. Für beides, für die äußere glänzende Form und für den inneren Wert, gebraucht Wolfram in gleicher Weise den Begriff tugent, und beides macht in gleicher Weise die êre des höfischen Ritters aus. Die Begriffe hövescheit, tugent, êre stehen hier also genau an der Stelle ihrer Entwicklung, wo sie noch äußerlich gemeint und doch schon verinnerlicht sind. Dass diese Mittelstellung der Abstrakta in der hochhöfischen Dichtung nicht (66) unproblematisch ist, beweist der êre-Begriff Gottfrieds - denn bei Gottfried meint dieser Begriff nur die gesellschaftliche Geltung und ist unabhängig von moralischen Qualitäten(167)-, beweist in umgekehrter Weise die Notwendigkeit, von inre tugende (Walther; L. 81,4) zu sprechen. Wenn Wolfram zwar auch die Möglichkeit eines Zerfalls in oberflächliches Ansehen und inneren Wert kennt (in einem schönen Körper kann ein Herz voller Falsch sein; 3,11-14), so kann er doch meist êre und tugent ohne Differenzierung in Außen und Innen gebrauchen. Der freundliche Gruß, mit dem Parzival den Menschen begegnen soll, ist also als Ausdruck seiner triuwe zu werten.
Das Ergebnis dieser Untersuchung über Herzeloydes Lehre ist eindeutig: die Ermahnungen der Mutter sind weder inhaltlich noch in der Art der Formulierung unzureichend; die Mutter trägt also keine Schuld an dem Irrweg des Sohnes. Denn auch ein letztes Argument: die Lehre der Mutter sei unzureichend, da Parzival erst durch die Belehrung des Gurnemanz von seiner tumpheit befreit werde, hat keine Beweiskraft; denn es ist durch nichts zu belegen, warum die Lehre des Gurnemanz geeigneter sei, die Torheit Parzivals zu überwinden: Parzival hätte die Lehren des Gurnemanz in gleicher Weise missverstehen können - wie dies nach Ansicht einiger Forscher auch geschieht, als er vor Anfortas steht.
An der Lehre der Mutter ist nichts mangelhaft; und wäre Parzival nicht verblendet gewesen, wäre er der Lehre in rechter Weise gefolgt, so hätte er keinen Fehltritt begangen und wäre seit seinem Ausritt aus Soltane der tadellose Ritter gewesen, der er durch Gurnemanz wird. Und als Parzivals Weg ins Artusrittertum vollendet ist: als er den Weg des Verderbens meidet, als seine Haltung durch ritters site und ritters mâl (179,14) bestimmt ist, als er sich in Condwiramurs die ideale Gattin errungen hat und sich als umsichtiger und um sein Volk besorgter König erweist, da entspricht sein Verhalten genau den höfischen Unterweisungen der Mutter.
Parzivals Kindheit als Symbol menschlicher Verblendung
Die Ursache für Parzivals tumpheit, die ihn auf dem Weg zu Gurnemanz bestimmt, und für deren zum Teil lächerliche, zum Teil unheilvolle Folgen kann also nicht in der Belehrung durch Herzeloyde gesucht werden; man muss umgekehrt argumentieren: die tumpheit ist Ursache dafür, dass Parzival eine an sich richtige Lehre so verfehlt befolgt, indem er sie allzu wörtlich nimmt. Andererseits kann nun auch nicht Parzival für sein verfehltes Verhalten verantwortlich gemacht werden: Sein art ist uneingeschränkt gut (vgl. o. S. 35 ff.), und auch sein Wille ist kein böser Wille, sondern ist selbstverständlich auf das Gute gerichtet. Von sündiger concupiscentia zu reden bei dem gutwilligen Gehorsam, mit dem Parzival die Lehren aufgreift, wenn auch nur so, alsez sînen witzen tohte (129,13) (167a), ist unzulässig. Der kindliche Unverstand, der Parzival hindert, die zuht so zu ver(67)stehen, dass sie, wie es ihr zukommt, den Menschen vor Verfehlungen bewahrt (vgl. o. S. 25 f.), hat mit sündhaft falscher Richtung des Willens nichts zu tun. tumpheit also und nicht böser Wille ist die Ursache für das Versagen Parzivals bei seinen ersten Versuchen, sich in der Welt zurechtzufinden, sich die Güter dieser Welt anzueignen (ein für Wolfram durchaus positives Ziel), tumpheit als Blindheit gegenüber dem, was jeweils das Richtige, das Gemäße ist. Und was als concupiscentia erscheint (die Art, wie er seine Wünsche - Ritter zu werden, eine Frau und eine Rüstung zu besitzen - befriedigt), ist die notwendige Folge dieser Blindheit (vgl. o. S. 14).)
Wolframs Darstellung der ersten Verfehlungen Parzivals bestätigt also, was im ersten Kapitel als Ursache jeder Verfehlung erarbeitet wurde: Der Mensch muss aufgrund der ihm wesenseigenen Nichtigkeit das ihm Gemäße verkennen und verfehlen. Da aber der Mensch nur Einsicht hat durch die Teilhabe an der göttlichen Vernunft (vgl. o. S. 13 f.), so wird die Trennung von Gott, dem Licht der Erkenntnis, als letzte Ursache für Parzivals Verfehlungen erkennbar, eine Trennung, die Parzival, da es ihm an gutem Willen nicht fehlt, nicht verschuldet haben kann.
Dass für Wolfram der Mensch unschuldig ist an seiner Schuld, kann bei der Betrachtung von Parzivals Kindheit durch einen Vergleich mit der Kindheitsdarstellung Augustins weiter erhellt werden: Augustinus lässt sich beim Bericht über seine Kindheit ganz vom Gedanken sündhafter concupiscentia leiten (u. a. conf. I,7,11); Wolfram dagegen verklärt Kindheit und Jugend seines Helden durch den Glanz der Unschuld. Dadurch wird bei Wolfram das in Unwissenheit irrende Kind zum treffenden Bild menschlicher Verblendung, an der der Mensch schuldlos ist.
An dieser Stelle kann auch deutlich gemacht werden, dass Wolframs Roman kein Entwicklungsroman im Sinne des 18. und 19. Jahrhunderts ist. Wolfram versteht den Prozess des Reifens vom Kind zum Mann nicht psychologisch, sondern theologisch: Die Darstellung der Entwicklung dient bei ihm der Erhellung des Verhältnisses von Nichtigkeit und Gnade, nicht der Erhellung des Reifeprozesses einer jugendlichen Psyche. Das
traeclîche wîs (4,18) bedeutet also nicht, dass Parzival auf dem Weg ins Artusrittertum allmählich nur zur Reife kommt. Wäre die Darstellung eines allmählichen Reifeprozesses für Wolfram wichtig gewesen, so hätte er auch Übergänge darstellen müssen(168). Doch solche Übergänge, selbst die zeitliche Distanz, die eine Entwicklung braucht, fehlen völlig: schlagartig, wie plötzlich von allen Fesseln befreit, besitzt Parzival nach der Belehrung durch Gurnemanz all das, was der site vorschreibt, ist er vollkommen gebildet. Darum kann traeclîche nicht mit ‚langsam’, sondern muss mit ‚untauglich’(169) übersetzt werden, traeclîche wîs bedeutet also, dass Parzival in untauglicher Weise wîs, dass er tump ist. Der Vers er küene, traeclîche wîs ist also vergleichbar der Formulierung tump unde wert (126,19; vgl. o. S. 37).(68)
Gurnemanz als Erzieher Parzivals
Durch Gurnemanz wird Parzival von seiner
tumpheit befreit. Doch wenn auch Gurnemanz wie kein anderer dazu berufen ist, Parzival zur zuht zu erziehen - denn er wird genannt:
. . . houbetman der wâren zuht.
des site was vor valsche fluht (162,23/24),
und bei allen Rittern ist er als der vorbildliche Erzieher bekannt (356, 22/23) -, so kann doch seine Erziehung ebensowenig, wie es die Herzeloydes konnte, dafür garantieren, dass sie erfolgreich ist. Wenn Gott nicht den Menschen erleuchtet, ist jede Belehrung unnütz; dies hat das Versagen von Herzeloydes Bemühungen gezeigt. So gibt Gurnemanz nur den Anstoß; die Schnelligkeit, mit der Parzival lernt, mit der sich das entfaltet, was im
art verborgen lag, weist darauf hin, dass dem mit Blindheit Geschlagenen nun gleichsam die Augen geöffnet werden. Wenn ihm die Augen geöffnet sind (sît er tumpheit âne wart; 179,23), kann er auch die Lehre der Mutter recht verstehen und in seinem Herzen bewahren.
Gurnemanz’ Lehre ist also nicht etwas grundsätzlich Neues gegenüber der Lehre Herzeloydes; und seine Erziehung hat keinen anderen Sinn als den, dass Parzival das, was er von der Mutter gelernt hat, in rechter Weise versteht, so dass sich sein Erbe voll entfalten kann.
Den Hintergrund der Lehre Herzeloydes bildete die triuwe des Menschen als Antwort auf die triuwe Gottes. Diese triuwe ist es, die das rechte Verhältnis zum Nächsten nie verfehlen lässt und sich als zuht und hövescheit äußert. So sind auch Gurnemanz’ Regeln der zuht nichts anderes als Weisungen zur triuwe: Der „Geist der christlichen Nächstenliebe wird in des Gurnemanz Lehre offen ausgesprochen"(170), sagt Keferstein, und Mockenhaupt spricht von der triuwe als dem „lebendigen Quellgrund aller Einzelvorschriften"(171) des Gurnemanz. Diese Aussagen entsprechen genau dem, was Wolfram über Gurnemanz sagt, denn dieser ist nicht nur der houbetman der waren zuht, sondern auch ein fürste ûz triwe erkorn (177,13) und der triwen rîche (166,2)(172). Die Beziehung seiner Lehre zur triuwe soll im folgenden im einzelnen nachgewiesen werden.
Die 'schame'
Gurnemanz beginnt seine Unterweisung mit der Mahnung:
ir sult niemer iuch verschemn (170,16).(173)
Durch die Formulierung, dass der verschamte lîp (170,17) ebenso wie der valsche (2,17-19), also der, dem die triuwe fehlt(174), der Hölle überantwortet sei (170,20), stellt Wolfram die Beziehung zwischen schame und triuwe selbst her; ebenso in den Versen, in denen er seinen Helden rechtfertigt: (69)
und dennoch mêr im was bereit
scham ob allen sînen siten.
den rehten valsch het er vermiten:
wan scham gît prîs ze lône
und ist doch der sêle krône.
scham ist ob siten ein güebet uop (319,6-11).(174a)
schame und triuwe sind also die Grundtugenden des höfischen Ritters:
dem (Ritter) sint zwuo rîche urbor gegebn,
rehtiu scham und werdiu triwe
gebent prîs alt unde niwe (321,28-30). (174b)
Die triuwe ist als Beweggrund aller übrigen ethischen Tugenden erkannt (vgl. o. S. 56 f.); wie aber steht die schame zur triuwe und wie zu den übrigen Tugenden, die als die Wirkungsweisen der triuwe gelten? Die Formulierung, dass die schame ein slôz ob allen siten (3,5) sei, führt hier weiter, denn slôz ob bedeutet sowohl den krönenden Abschluss als auch den Verschluss, der das Eingeschlossene gänzlich umfasst (Frau Minne gilt als slôz ob dem sinne; 292,28; diese Fessel kann vermieden werden, wenn die zuht slôz ob minne site ist; 643,8).
Es ist aber das Gewissen, das die siten durch einen Maßstab bindet, so dass sie ihr rechtes Maß haben. Der rechte Maßstab ist die von Gott gesetzte Ordnung (vgl. u. S. 74), in der jedem das Seine, das ihm Gemäße zugeteilt ist(175). Um diesen Maßstab zu wissen und aus diesem Wissen heraus zu handeln, ist Aufgabe der schame, die also ohne die wîsheit fruchtlos bleibt (vgl. u. S. 74). Den gemäßen Standort (Ethos) eines jeden erkennend und so jedes Handeln leitend, wird die schame zum Maßstab und zum Ursprung jeder ethischen Tugend, so dass sie dort, wo solche philosophische Unterscheidungen nicht bedacht werden (H. Hempel spricht von „wechselnder Bedeutung„ der „ethischen Begriffe"(176)), mit der zuht als dem Gesamt dieser Tugenden und auch mit einzelnen dieser Tugenden identisch gesetzt werden kann. Auf diese Weise erklärt sich die Beobachtung, dass zuht und schame (vgl. 369,6/7) (177) „eng miteinander gekoppelt und mehr oder weniger im Variationsverhältnis zueinander auftreten"(178).
Das Gemäße, aufgrund dessen die schame als das Gewissen(179) urteilt, ist seinerseits bestimmt durch die triuwe, die Maßstab für jedes Handeln ist, so dass man die schame als das Gewissen der triuwe bezeichnen kann.
Als Gewissen der triuwe aber ist schame vor allem auf den Andern bezogen, ist sie das „Empfinden, das jede - innere - Verletzung eines anderen Menschen meidet"(180), oder - wie Hempel formuliert - „das empfindliche Rechts- und Schicklichkeitsgefühl, das jede Verletzung fremden Menschentums meidet und, wo sie durch Andere geschieht, mit entschiedener Verwerfung beantwortet"(178). Darum kann schame wie auch zuht (vgl. o. S. 56 f.) synonym mit erberme(181)stehen. (70)
Interpretiert man das Wort schame von der Etymologie her (indog. Wurzel *kam-: *kem-: ‚bedecken, verhüllen’) (182), so wäre schame zunächst als Folge einer Blöße, die man sich durch eine Verfehlung gegeben hat, zu definieren. Notwendig gehört dann zur schame der Andere, vor dem man die Verfehlung verbergen möchte und um dessentwillen die Entdeckung der Verfehlung als Schande empfunden wird. Was von der Öffentlichkeit her gesehen Schande ist, dessen schämt sich der Betroffene. Im Verlauf der Ausbildung seelischer Vorgänge kam zu der objektiven Bedeutung der schame (Schande) die verinnerlichte, subjektive (Empfindung der Ursache dieser Schande) hinzu. Im Mhd. sind beide Bedeutungen lebendig (183); denn zu Wolframs Zeit gehörte die Achtung der Öffentlichkeit noch wesentlich zur Sittlichkeit dazu, und die Qual der Scham entsprach dem Verlust der êre in der Gesellschaft:
sô müezet ir gunêret sîn
und immer dulten schemeden pîn (172,27/28).(183a)
Doch die schame peinigt den Betroffenen nicht deshalb, weil er die êre verloren hat, sondern weil er sie wegen seiner Verfehlung verloren hat; denn in einer durch und durch gesitteten Gesellschaft, wie sie für Wolframs Roman vorausgesetzt werden muss, in der der äußere Schein nie etwas anderes ist als der Ausdruck innerer Haltung, verliert nur der die êre, der eine Verfehlung begangen hat; die Sorge um die Anerkennung der Gesellschaft widerstreitet nicht der Achtung des Einzelnen vor sich selbst. Die êre ist (noch) nicht in eine innere und äußere zerfallen (vgl. o. S. 65 f.); eine Diskrepanz von Schein und Sein, von öffentlicher Geltung und persönlichem Gewissen kennt Wolfram nicht, da die Öffentlichkeit, das heißt aber: die durch triuwe verbundene Gesellschaft, als normgebend voll akzeptiert ist.
Wer also durch die schame aus triuwe handelt, wer den Mitmenschen mit Achtung, mit Rücksicht und Nachsicht begegnet und alle seine Tauglichkeiten in ihren Dienst stellt, der besitzt werdekeit(184) (170,19), der ist selber geachtet, weil er nach den Wertvorstellungen des Rittertums lebt. Wem aber die schame fehlt, wer nicht auf die gesellschaftlichen Normen achtet, der verfehlt die Haltung der triuwe und ist, da er dem ersten und größten Gebot Gottes zuwider handelt, der Hölle verfallen (170,20; vgl. o. S. 68).
Die schame hat also bei Wolfram eine doppelte Funktion: l. Wer sie besitzt, achtet das Rechte und meidet die Verfehlung, um nicht die Achtung der anderen zu verlieren; auch fühlt er sich verletzt, wenn andere sich vergehen(185). 2. Wer sich vergangen hat und von ,Scham erfüllt' ist, empfindet Schmerz (pîn) darüber, dass er der durch triuwe verbundenen Gesellschaft geschadet und sich so außerhalb dieser Gesellschaft gestellt hat. Für diese doppelte Funktion hat J. Derbolav(186)die unterscheidenden (71) Begriffe ‚potentielle’ und ‚verarbeitete’ Scham geprägt. Jene stellt er in die Nähe der Ehrfurcht, diese in die Nähe der Reue; jene entspricht also dem heutigen Begriff ‚Gewissen’, diese dem des ‚schlechten Gewissens’. Da aber die Helden Wolframs zumeist selbstverständlich das Rechte tun, bedeutet schame bei Wolfram meist soviel wie Ehrfurcht, Achtung vor den sittlichen Normen der Gesellschaft:
scham ist ob siten ein güebet uop (319,11) (187).
Der Ausdruck schemeden pîn aber weist darauf hin, dass Wolfram auch die zweite Funktion der schame kennt. Daraus folgt, da die Menschen nach Wolframs Darstellung ohne ihren Willen, also ohne ihre Schuld die Normen der triuwe verletzen, dass auch der, der ohne Schuld schuldig wird, unter dem Leid, das durch seine Verfehlung entsteht, leidet und sich aus der Gesellschaft, der er geschadet hat, ausgeschlossen fühlt - die Situation Parzivals nach der Verfluchung durch Cundrie, in der sich die Warnung des Gurnemanz erfüllt:
sô müezet ir gunêret sîn
und immer dulten schemeden pîn (172,27/28).
Erbarmen und ,minne' als Äußerungen der ,triuwe'
Die weiteren Unterweisungen des Gurnemanz entfalten die ritterliche Ethik (zuht), die der schame als Richtschnur dient. Der Inhalt dieser Belehrung weist darauf hin, dass die
triuwe tatsächlich „lebendiger Quellgrund aller Einzelvorschriften„ (vgl. o. S. 68) ist. triuwe als Liebe zu Gott, die sich als Nächstenliebe zeigt (vgl. o. S. 53; S. 56), besitzt der Ritter, der sich der Bedrängten erbarmt, ihre Not und Sorge lindert. Dabei helfen ihm die Tugenden milte, güete und diemüete. milte und güete bedeuten ein freigebiges und freundlich-barmherziges Wohltun; die diemüete bewirkt in diesem Zusammenhang, dass man nicht gibt wie der Herr dem Knecht, mit Herablassung (es geht in der Belehrung um die milte und güete des Königs zu seinem Volk; 170,21/22), sondern gemäß der Forderung der triuwe wie ein Bruder dem anderen. Auch hier ist der Sinn der christlichen Lehre von der Nächstenliebe voll erfasst; und so verheißt Gurnemanz dem, der solcher Forderung genügt:
sô nâhet iu der gotes gruoz (171,4).
Wie bei Herzeloyde (vgl. o. S. 63) gipfelt auch
bei Gurnemanz die Ritterlehre im Preis
werder minne
(172,15); diese minne lebt von der Achtung dem Andern gegenüber, von Aufrichtigkeit, Beständigkeit und Rücksichtnahme, also durch triuwe, und sie findet in der Ehe ihre Erfüllung:
man und wîp diu sint al ein;
als diu sunn diu hiute schein,
und ouch der name der heizet tac. (72)
der enwederz sich gescheiden mac:
si blüent ûz eime kerne gar.
des nemet künsteclîche war (173,1-6; vgl. 203,5; 740,29/30). (187a)
Ein Beispiel dafür, dass für Parzival, wie Herzeloyde und Gurnemanz es lehrten, reht minne wâriu triuwe (532,10; vgl. p. S. 49) ist, gibt Wolfram dort, wo Parzival in den drei ersten Nächten seiner Ehe mit Condwiramurs die künegîn . . . maget liez (202,22). Parzivals Verhalten ist für Wolfram Zeichen der
triuwe des Mannes der Frau gegenüber, die durch gît (202,13/14) zu entwürdigen nicht der minne, die aus der triuwe lebt, entspricht:
des mâze ie sich bewarte,
der getriwe staete man
wol friwendinne schônen kan (202,2-4).
Nachdem Parzival gezeigt hat, dass nicht gît, sondern triuwe ihn an Condwiramurs bindet(188), kann er, wie ihm seine Erzieher rieten, in der ehelichen Umarmung der Einheit von man und wîp, in der sich die triuwe erfüllt, Ausdruck geben.
Zur Einheit des durch die triuwe begründeten Bundes gehört auch der zeitliche Aspekt: die staete der minne; zur minne, die als Äußerung der triuwe verstanden wird, gehört die Treue. Diese Treue hat ihren Ursprung nicht im Pflichtbewusstsein, sondern ist selbstverständliches Ergebnis der triuwe. Obwohl Parzival mannigfachen Versuchungen zur Treulosigkeit ausgesetzt ist (z. B. durch Orgeluse), bleibt seine minne âne wenken (283,15):
Nu dâhte aber Parzivâl
an sîn wîp die lieht gemâl
und an ir kiuschen süeze.
ob er kein ander grüeze,
daz er dienst nâch minne biete
und sich unstaete niete?
solch minne wirt von im gespart.
grôz triwe het im sô bewahrt
sîn manlîch herze und ouch den lîp,
daz für wâr nie ander wîp
wart gewaldec sîner minne,
niwan diu küneginne
Condwîr âmûrs
diu geflôrierte bêâ flûrs (732,1-14; vgl. 282,23). (188a)
Die ,mâze’
Man hat geglaubt, die Erzählung von den drei ersten Nächten der Ehe Parzivals (Ähnliches gilt für Parzivals Schweigsamkeit bei seiner ersten Begegnung mit Condwiramurs) weise mehr spielerisch als gewichtig darauf (73) hin, dass Parzival die Lehre der ritterlichen zuht hingenommen habe, ohne an sie die Frage nach ihrem Sinn zu stellen, ohne sie mit dem Herzen begriffen, ohne sie sich so zu eigen gemacht zu haben, dass er frei über sie verfügen könnte. Habe sich seine Natur vor der Erziehung durch Gurnemanz ungebändigt geäußert (die rücksichtslose Umarmung Jeschutes), so sei er nun ins andere Extrem gefallen: er halte sich starr an die gelernte Regel und an die in des Gurnemanz Burg gemachten Erfahrungen, und deshalb erscheine er allzu gebändigt, sein ‚natürliches Gefühl’ sei gelähmt; darum vollziehe er die Ehe mit Condwiramurs erst dann, als er sich an des Gurnemanz und seiner Mutter Lehre erinnert.
An dieser Interpretation ist Verschiedenes unrichtig: Bei der Begegnung mit Jeschute folgt er nicht im wesentlichen seiner ungebändigten Natur, sondern der Lehre seiner Mutter, deren gemäßes Verständnis ihm versagt geblieben ist. Dem Argument, dass er sich nur darum mit Condwiramurs vereinige, weil er sich an die Weisung des Gurnemanz und der Mutter erinnere, widerspricht die Überlegung, dass er sich dann schon in der ersten Nacht an sie hätte erinnern können. Der These, Parzival halte sich starr an die gelernte Regel, er sei also allzu gebändigt, widerspricht Wolframs Interpretation dieser Szene: Für Wolfram ist das Verhalten Parzivals ein Zeichen der mâze (202,2).
Über die mâze hatte Gurnemanz Parzival belehrt:
gebt rehter mâze ir orden (171,13).
Mit mâze bezeichnet Wolfram ähnlich wie mit kiusche(189) die Haltung, die aus dem Wissen um das jeweilig Gemäße lebt(190); mâze bedeutet also für Wolfram nicht mäßichait(191), das später an die Stelle der mâze tritt, bedeutet auch nicht mittelmâze, das zum ersten Mal bei Reinmar von Zweter erscheint(193). Wer die mâze besitzt, kennt den Maßstab, mit dem die schame messen muss. Jedes Handeln, das aus dem Wissen um das rechte Maß heraus geschieht, bemüht sich um die Vollendung des jeweilig Möglichen, hat darum mit Mittelmäßigkeit nichts zu tun. Jede Tugend kann folglich nur durch die mâze das sein, was sie sein soll(194), denn es ist Aufgabe der Tugend, jedes in seine ihm gemäße Vollkommenheit zu bringen und darin zu halten; diese Aufgabe aber kann sie nur erfüllen, wenn sie durch das Wissen um das rechte Maß bestimmt ist. Die milte z. B. gibt jedem das, was ihm zusteht; fehlte der milte die mâze, so gäbe des Volkes hêrre (170,22) entweder so verschwenderisch, dass er selbst schließlich zu arm würde und so den ihm gemäßen Lebensbereich verfehlen müsste, oder aber er würde, wenn er die Armut vermeiden wollte und keine mâze hätte, zum Geizhals; in beiden Fällen würde er die êre verlieren. Die milte ohne die mâze wäre also keine milte (171,7-12).
Und ebenso ist Gerechtigkeit ohne mâze undenkbar, weil erst der, der um das rechte Maß weiß, dem anderen das ihm Gemäße gewährt: (74)
diu rehte mâz diu hât ir zil
enzwischen lützel unde vil.
swer mit der mâz kan mezzen wol,
der tuot ez allez als er sol.
man sol mezzen nâch sîner kraft,
unmâze ist an übermaht.
man sol mezzen grôz und kleine,
diu rehte mâz sol sîn gemeine!
verliese wir mâze, wâge, zal,
daz ist dem rehte ein michel val (195).
Wer gerecht messen will, bedarf also zweierlei: erstens des rechten Maßstabs, an dem man misst, und zweitens der Einsicht in das rechte Maß.
Der rechte Maßstab ist notwendig, da es zweierlei Weisen, zu messen gibt. Man kann dasselbe groß nennen, wenn man es an Kleinerem, und klein, wenn man es an Größerem misst; man kann beliebig die Hinsichten wechseln und so stets das als das Angemessene hinstellen, was einem jeweils am günstigsten erscheint: ein maßloses Messen. Dieses maßlose Messen wird vermieden durch das gemäße Maß, an dem man misst, durch ein herrschendes Maß, das nicht zulässt, dass man beliebig die Hinsichten wechselt, einmal so, dann wieder so misst, durch ein feststehendes, unwandelbares Maß, das vom Menschen und seinen wechselnden Hinsichten unabhängig ist. Dieses Maß spricht für den hochhöfischen Menschen durch die Normen der zuht. Diese Normen werden aber darum nicht als willkürlich, dem Einzelnen und der jeweiligen Situation nicht angemessen empfunden, weil sie von Gott sind; und Gott, alles wissend und überschauend, ist nicht an die sich jeweils ändernden Ansichten und Hinsichten gebunden: darum können seine Weisungen als das unwandelbare Maß genommen werden:
Got hât allen dingen gegeben
die mâze, wie si sulen leben(196).
Der Mensch aber darf nicht sinnlos die Normen lernen und sinnlos nach ihnen handeln, sondern muss das Maß begreifen, das sie zu gerechten Normen macht. Darum ist wîsheit, bescheidenheit (197) die Voraussetzung maßvollen Handelns(198), und Gurnemanz beginnt die Lehre über die mâze mit den Worten: ir sult bescheidenlîche (171,7)(199). Parzival, der von der tumpheit befreit ist, wird also die Lehre, die er von Gurnemanz hört, in maßvoller Weise anwenden und nicht durch Vorschriften allzu gebändigt sein.
Die mâze bestimmt, dass jedes in seinem Eigenen anerkannt wird. So muss vor allem in der Sprache die mâze wirken, damit nicht der Angesprochene gegen seinen Willen von seinem Standort gedrängt wird. Die Rede darf den Angeredeten nicht vergewaltigen, sondern muss ihm die Freiheit lassen, nach seiner Einsicht dem Gehörten zuzustimmen oder es abzulehnen (200).
(75) Wer das Eigene des Gegenüber respektiert, wird ihn auch nicht mit indiskreten Fragen überfallen, sondern ihn frei sich offenbaren lassen(201). Wird das Gespräch unter dieser Voraussetzung geführt, kann man auch selber frei und offen dem anderen gegenüberstehen und braucht sich ihm nicht zu verschließen; man kann seinen klugen Fragen klug und überlegt, d. h. maßvoll antworten:
im sult niht vil gevrâgen:
ouch sol iuch niht betrâgen
bedâhter gegenrede, diu gê
reht als jenes vrâgen stê,
der iuch wil mit worten spehen (171,17-21). (201a)
Im übrigen möge der Mensch verständig und mit offenen Sinnen durch die Welt gehen (171,22-24).
An der Regel der zuht: irn sult niht vil gevrâgen scheitert Parzival. Doch durch die Regel selbst kann dieses Scheitern nicht begründet werden, denn sie ist eine Forderung der mâze: sie achtet rücksichtsvoll auf die Eigenständigkeit des anderen und entspricht so dem christlichen Gebot der Nächstenliebe: „Es ist das Gegenteil von egozentrischem Verhalten"(202); egozentrisch wäre eine ungebändigte, rücksichtslose Neugier. Parzival darf erwarten, dass man ihn über das Merkwürdige, das er sieht, noch aufklären wird (239,17), so dass er, wenn es nötig und möglich ist, auch helfen kann. Was für den Augenblick das Rücksichtsvollste ist, das tut er: er schweigt und reißt nicht aus Neugier, einen Skandal zu erfahren, Wunden auf. Rupp schreibt dazu: „. . . das ist nicht fehlendes Mitleid (Parzival ist immer mitleidig, wie uns Wolfram deutlich genug zu verstehen gibt), es ist die selbstverständliche Zurückhaltung eines jungen Mannes, bewusst und richtig vermiedene
curiositas."(203) Und mit Recht fragt O. G. v. Simson: „Ja, ist sein Schweigen angesichts des Schauspiels auf der Gralsburg, in welcher das Leiden von dem wundersamen Gepränge gleichsam verhüllt zu sein scheint, nicht gerade als Ausdruck der Ehrfurcht, der Bescheidenheit überzeugender als jede Frage es sein könnte?"(204)
Gurnemanz’ rât verweist also auf die triuwe und ist somit gerechtfertigt. Es gibt in der Forschung aber nicht nur Kritik an dem rât selbst, sondern auch an der Art, wie er von Parzival befolgt wird. Vor allem Keferstein glaubte, dass die hochhöfische Ethik zu „idealen und absolut gültigen Anstandsregeln„ (vgl. o. S. 32) erstarrt sei. Wie in den ersten Ehenächten, so klammere sich Parzival auch vor Anfortas an eine gelernte Regel, halte das Befolgen dieser Regel für so wichtig, dass er ihr ohne Rücksicht auf die Situation, in der er sich befindet, gehorche und nicht in der Lage sei, auf sein Herz zu hören. So verfälsche Parzival die Lehre des Gurnemanz „zu abstrakten Gesetzen . . ., die unter allen ,Umständen’ und unabhängig von der konkreten Lage an und für sich und ideal gelten"
(205).
(76) Nun ist der Hinweis: irn sult niht vil gevrâgen so formuliert, dass Parzival auf die Haltung der mâze verwiesen wird, auf das Wissen, ob die Befolgung
dieser Regel dem Augenblick angemessen ist. Die Forderung: irn sult niht vil gevrâgen setzt also des Gurnemanz rât, gebt rehter mâze ir orden (171,13), voraus, es heißt nicht: du sollst nie (206) fragen, sondern: ,Fragt bitte (207) nicht zuviel, fragt bitte nur dann, wenn Ihr es für angemessen haltet, wenn die Rücksicht auf den Nächsten es erlaubt’. Gurnemanz appelliert also an Parzivals Einsicht in das jeweils Gemäße, nicht an den Gehorsam, der blindlings tut, was man ihm befiehlt. Und Parzival wiederholt den Satz so, wie er ihn verstanden hat:
ich solte vil gevrâgen niht (239,13).
Als Parzival zum ersten Mal des Gurnemanz’ rât befolgt - als er vor Condwiramurs geführt wird -, macht Wolfram seine Befolgung ausdrücklich von der bescheidenheit abhängig:
sîn manlîch zuht was im sô ganz,
sît in der werde Gurnamanz
von sîner tumpheit geschiet
unde im vrâgen widerriet,
ez enwaere bescheidenlîche (188,15-19). (201a)
Parzival weiß also, seit er Gurnemanz verlassen hat, um das rechte Maß. Kefersteins These von der Verabsolutierung eines Werts, die zur Erstarrung der Ethik führe(208), kann demnach vom Text her nicht belegt werden; im Gegenteil: Dass Parzival auf der Gralsburg wieder in seine alte tumpheit zurückfiele, die ihn der Mutter Lehren, und zwar alle, verfehlen ließ, und zwar nur dieses eine Mal, widerspräche nicht nur dem Bild, das Wolfram von Parzival zeichnet, sondern spräche auch gegen eine vernünftige Komposition des Romans.
An zwei Beispielen wird die mâze im Kampf gezeigt: Der Ritter soll nicht maßlos den Kampf über alles stellen, sondern auch die andere Seite des Rittertums genießen: gereinigt von Schmutz und Staub des Kampfes soll er sich um die Gunst der Frauen bemühen (171,25-172,6). Vor allem darf er nicht leichtfertig mit dem Leben seiner Mitmenschen umgehen:
lât derbärme bî der vrävel sîn (171,25).
An diesem letzten Beispiel wird noch einmal deutlich, wie sehr die mâze auf die triuwe bezogen ist: Durch die mâze berücksichtigt der Mensch das Gemäße eines jeden, anerkennt er jeden in seiner Art, sieht er sich selbst demütig als Geschöpf Gottes und die anderen als seine Brüder (vgl. o. S. 53), deren Leben ihm darum heilig ist. Die Ethik der mâze und eine von der Charitas geprägte Ethik schließen sich nicht aus, sondern entsprechen sich. (77)
Unverständlichkeit von Parzivals Verdammung (Zusammenfassung)
Die Untersuchungen über Parzivals Anlagen und Erziehung bestätigen das im l. Kapitel erarbeitete Menschen- und Gottesbild Wolframs: Da weder der art noch die christlich-ritterliche Erziehung Parzivals und deren Ergebnis in irgendeiner Weise negativ beurteilt werden, können die Schuld und das Leid Parzivals nicht als die Folge eines strafwürdig bösen Verhaltens angesehen werden. Parzivals art ist nach den Vorstellungen Wolframs von Gott bestimmt und damit zugleich auch die Richtung seines Willens. Die Verfehlungen, die Parzival vor seiner Belehrung durch Gurnemanz begangen hat, können also nicht aus Bösartigkeit oder Böswilligkeit geschehen sein; die tumpheit Parzivals, die als Ursache für diese Verfehlungen gedeutet werden muss, kann nicht als Folge eines bösen art oder eines bösen, selbstsüchtigen Willens angesehen werden. Parzival handelt so, dass er seinem art treu bleibt, und er handelt nicht in böser, sondern in bester Absicht.
Während Parzivals Verhalten vor seiner Erziehung durch Gurnemanz objektiv falsch ist und darum durch die tumpheit entschuldigt werden muss, kann das Unterlassen der Frage in anderer Weise gerechtfertigt werden. Bei der Interpretation dieses zentralen Geschehens, das zur Verfluchung Parzivals führt, ist das richtige Verständnis von zuht von wesentlicher Bedeutung. Ein Großteil der Forschung argumentiert: Indem Parzival sich an die zuht gehalten habe, habe er nicht wie ein Christ und darum strafwürdig gehandelt; sein Ethos sei nicht von christlichem Geist erfüllt gewesen, und darum sei er gescheitert; die zuht der Artusritter sei wertlos. Das wahre Ethos aber besäßen die G r a l s r i t t e r, nicht die Artusritter, und erst, wenn Parzival zum Gralsrittertum reif sei, handle er nach dem Maßstab, mit dem Wolfram das Ethos seiner Gestalten messe.
Es ist aber gezeigt worden, dass mit dem Wort zuht das Ethos des christlichen Ritters bezeichnet wird: die zuht wurzelt in der triuwe und ist so ein Abbild der Tugenden dessen, der selbe ein triuwe ist (462,19); wenn der Ritter durch zuht handelt, geschieht es nicht aus Sorge um seinen Ruf, sondern aus Liebe zum Nächsten (vgl. o. S. 56 f.). Als Ritter der zuht lebt also Parzival nicht im Zustand der Gottferne (vgl. o. S. 30), ist er nicht ein Sünder, sondern der Gerechtfertigte, Erlöste: er lebt in der Gnade Gottes, und diese Gnade lebt und wirkt in ihm (vgl. o. S. 25 f.). Wenn die Forschung glaubt, Parzival und das Artusrittertum wegen der zuht kritisieren und diesem Rittertum ein ‚christlicheres’ Ethos, das der Gralsritter, entgegensetzen zu müssen, so kritisiert sie dieses Rittertum an einem Maßstab, dem es immer schon gewachsen ist, und also muss eine Kritik dieser Art sinnlos sein oder aber zuvor den Artusrittern Mängel zuschreiben, die Wolfram an ihnen nicht gesehen hat. In der Dichtung werden auch die Artusritter dem Maßstab gerecht, von dem die Forschung meinte, dass nur das Gralsrittertum ihm entspreche. Denn die zuht der Artusritter ist nichts (78) anderes als die triuwe der Gralsritter, und darum herrscht die zuht am Gralshof in gleicher Weise wie am Artushof(209), und die Artusritter handeln ebenso aus triuwe wie die Gralsritter. Der Weg Parzivals vom Artushof zum Gral kann also nicht so interpretiert werden, dass Parzival eine neue Christlichkeit gewinne - es gibt kein falsches oder veraltetes Christentum in Wolframs Roman -; und es stellt sich die Aufgabe, diesen Weg anders zu deuten.
Wenn aber die Artusritter diesem einen Maßstab für das, was christliches Ethos ist, gerecht werden, wenn dieses Ethos im Begriff der durch triuwe verlebendigten zuht voll erfasst ist, so ist Parzivals Schuld auf der Gralsburg nicht mehr ohne weiteres zu begreifen. Simson spricht mit Recht vom „Geheimnisvollen dieses Schuldbegriffs"(210); und „Parzivals Sünde ist im Sinne christlicher Ethik"(210) nicht „gering"(210), wie Simson meint, sondern gar nicht vorhanden. Darum wird Parzival von jeder Schuld freigesprochen, und zwar dreifach: vom Artushof, von Cundrie bzw. Sigune und vom Erzähler selbst.
Die Frauen des Artushofes weinen und klagen über das Unglück, das Parzival durch die Verfluchung Cundries getroffen hat (319,12-19; vgl. 332,27-30); der ganze Artushof fällt in Trauer:
dâ was trûren âne zal (326,10)(211);
er muss die Verfluchung Cundries als ungerechtes, rätselhaftes Geschehen deuten, denn von der Sicht der Artusritter her behält Parzival weiterhin seine êre:
nu sol ein ieslîch Bertenoys
sich vröun daz uns der helt ist komn,
da prîs mit wârheit ist vemomn
an im und ouch an Gahmurete.
reht werdekeit was sîn gewete (325,30-326,4). (211a)
Als Parzival später zum Artushof zurückkehrt, heißt es:
die in dâ komen sâhen,
hôhes prîss sim alle jâhen (694,29/30).
Ohne Zögern nimmt Artus ihn noch vor Cundries Widerruf wieder in die Gemeinschaft auf (700,23/24).
Da Parzival, gemessen am Maß christlich-ritterlicher Ethik, unschuldig ist, als er Anfortas nicht erlöst, darf man nicht, wie es manchmal geschehen ist, die Peripetien der Handlung von Wolframs Roman (Herrlichkeit-Leid-Herrlichkeit) denen der Hartmannschen Artus-Romane gleichsetzen. Erec z. B. fällt in Leid, weil er, am Maßstab ritterlicher Ethik gemessen, schuldig geworden ist: es ist ja gerade die Gesellschaft des Artushofes, die ihn (79) verstößt(212). Parzival dagegen bleibt in den Augen der Artusgesellschaft der unbescholtene Held (213).
Weiterhin wird Parzival dadurch von Schuld freigesprochen, „dass Sigune . . . ihren Vorwurf durch ihre Verzeihung mildert oder gar aufhebt und dass Cundrie im 15. Buch ihren Fluch ausdrücklich und in aller Form zurücknimmt"(214), ja sogar Parzival um Verzeihung bittet:
si warp daz ein râche
ûf si verkoren waere (779,12/13). (214a)
si viel mit zuht, diu an ir was,
Parzivâle an sînen fuoz,
si warp al weinde umb sînen gruoz,
sô daz er zorn gein ir verlür
und âne kus ûf si verkür (779,22-26). (214b)
Mit ausdrucksstarken Worten bekennt Cundrie sich schuldig, weil sie Parzival verflucht habe, und dankt ihm, als er ihr verziehen hat:
sie neig in unde sagte in danc,
die ir nâch grôzer schulde
geholfen heten hulde (780,4-6). (214c)
Auch Cundrie steht auf dem Boden des Artusrittertums: sie preist Ither, Gahmuret und Feirefiz als vorbildliche Ritter; sie lädt zu einer âventiure ein, wie sie für einen Artusroman nicht passender sein kann: zur Befreiung der Frauen auf Schastelmarveile. Und so nimmt denn Gawan, der typische Artusritter, diese
âventiure auf sich. Auch Cundrie also kann die Schuld Parzivals nicht begreifen; auch sie kennt keinen anderen Maßstab als den, mit dem die Artusritter messen und an dem gemessen Parzivals Verhalten ohne Tadel war. Darum hatte Cundrie, als sie als Gralsbotin Parzival verfluchte, ohne zuht gehandelt (312,3/4), hatte ihn, wie sie glauben muss, ungerechterweise ins Leid gestürzt; darum bittet sie Parzival um Verzeihung.
Da schließlich der Erzähler selbst ebenfalls keinen anderen Maßstab kennt als den der zuht, muss auch er Parzival von jeder Schuld freisprechen (vgl. o. S. 57 f.), und er kann dies nicht nachdrücklicher tun, als wenn er seinem Helden manheit und zuht, schame und triuwe zuspricht:
waz half in küenes herzen rât
unt wâriu zuht bî manheit?
und dennoch mêr im was bereit
scham ob allen sînen siten.
den rehten valsch het er vermiten:
wan scham git prîs ze lône
und ist doch der sêle krône.
scham ist ob siten ein güebet uop (319,4-11) (215).
(80) Parzival ist also schuldlos, schuldlos an seinen Verfehlungen, aus denen ihm und anderen Leid kommt, schuldlos auch daran, dass sogar durch sein rechtes Verhalten, durch seine
zuht Schuld und Leid entstehen. Wenn aber Parzival schuldlos ist an dieser Schuld und an diesem Leid, wenn damit zugleich die Vorstellung, dass der Mensch durch seine Sünden schuldig und dass das Leid die gerechte Strafe für diese Sünden sei, als unzulänglich abgewiesen ist, so tritt die Frage nach dem Sinn von Parzivals Leid in den Vordergrund. (81)
|