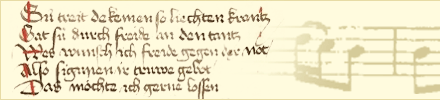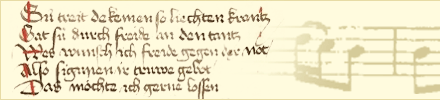Friedrich Hölderlin
Patmos
Dem Landgrafen von Homburg
In einem Seminar bei W. Binder hatte ich eine Arbeit über die Strophen 10-14 geschrieben (s. u.).
Natürlich musste ich mich auch mit den Strophen davor beschäftigten. Meine Notizen dazu habe ich später zusammengeschrieben. Nun, knapp 60 Jahre später und ohne weitere Beschäftigung mit Hölderlin, meine ich, dass diese Notizen und die Seminararbeit vielleicht doch einem Interessierten nützlich sein könnten.
Die Patmoshymne wurde 1801 konzipiert - zugleich mit der Rheinhymne und der Friedensfeier -, zu Beginn des Jahres 1803 in der vorliegenden Fassung vollendet. Bald darauf lähmte der Wahnsinn, der ihn 1802 schon einmal überfallen hatte, seine Schaffenskraft.
Von einem 31- bzw. 33-Jährigen geschrieben, trägt die Hymne doch alle typischen Merkmale eines Spätwerks.
Spätwerke: Goethes ‚Divan’, ‚Dichtung und Wahrheit’, der Choral der zwei geharnischten aus Mozarts Zauberflöte, Beethovens letzte Streichquartette und Klaviersonaten, Bachs ‚Kunst der Fuge’, Rembrandts Spätwerk u. a..
Hölderlins klassische Zeit war die der großen Oden und Elegien aus den Jahren 1799 und 1800.
Klassisch ist die Vollendung der Form durch die Wahl treffender Bilder, durch die passende Komposition der Farben und Klänge, durch eine unübertroffene Kultivierung des Klanglichen, etwa durch Vermeidung der Hiate und durch ein höchst sensibles Gefühl für Rhythmus, z. B. für das Verhältnis von Versmetrik und natürlichem Sprachrhythmus.
In Alterswerken sprengt der geistige Anspruch die formale klassische Geschlossenheit, fordert neue Gestaltungsprinzipien, sozusagen vergeistigtere (in der Musik beispielsweise das Formprinzip des Kontrapunkts). Durch das Auseinanderfallen der Geschlossenheit ist die Form weiter gespannt und offener, durchscheinender. Verlust an Geschlossenheit bedeutet nicht Verlust an Formgestaltung, vielmehr herrscht bei der Gestaltung eine noch größere Strenge.
So ist die Hymne ‚Patmos’ äußerst streng komponiert, im Großen wie im Detail.
Die 15 Strophen mit je 15 Versen (Ausnahme Strophe 10: 16 Verse) sind in fünf Gruppen zu je drei inhaltlich zusammengehörenden Strophen (Triaden) eingeteilt.
Alle Verse sind steigend (d. h. sie beginnen mit einem Auftakt) oder sie beginnen mit schwebender Betonung.
Der Rhythmus (gebildet durch Länge der Verse, durch Anzahl der Senkungen u. a.) passt sich der Aussage an.
Die Sangart der Hymnen ist von härtester Sprachfügung; Hölderlin nennt sie die deutsche oder vaterländische Sangart – ‚deutsch’ und ‚vaterländisch’ sind für Hölderlin symbolische, keine politischen Begriffe.
Strophe 1 – 3
Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Im Finstern wohnen
Die Adler und furchtlos gehn
Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg
Auf leichtgebaueten Brüken.
Drum, da gehäuft sind rings
Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten
Nah wohnen, ermattend auf
Getrenntesten Bergen,
So gieb unschuldig Wasser,
O Fittige gieb uns, treuesten Sinns
Hinüberzugehn und wiederzukehren.
So sprach ich, da entführte
Mich schneller, denn ich vermuthet
Und weit, wohin ich nimmer
Zu kommen gedacht, ein Genius mich
Vom eigenen Hauß'. Es dämmerten
Im Zwielicht, da ich gieng
Der schattige Wald
Und die sehnsüchtigen Bäche
Der Heimath; nimmer kannt' ich die Länder;
Doch bald, in frischem Glanze,
Geheimnißvoll
Im goldenen Rauche, blühte
Schnellaufgewachsen,
Mit Schritten der Sonne,
Mit tausend Gipfeln duftend,
Mir Asia auf, und geblendet sucht'
Ich eines, das ich kennete, denn ungewohnt
War ich der breiten Gassen, wo herab
Vom Tmolus fährt
Der goldgeschmükte Pactol
Und Taurus stehet und Messogis,
Und voll von Blumen der Garten,
Ein stilles Feuer; aber im Lichte
Blüht hoch der silberne Schnee;
Und Zeug unsterblichen Lebens
An unzugangbaren Wänden
Uralt der Epheu wächst und getragen sind
Von lebenden Säulen, Cedern und Lorbeern
Die feierlichen,
Die göttlichgebauten Palläste.
Der erste Satz der Patmoshymne
Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
spricht aus der Situation der Endzeiterwartung, der Erwartung der nahen Ankunft Gottes, der Zeit der Erlösung1), wie sie das Urchristentum 2), aber auch Vergil kannte (4. Ekloge).
…Denn voll Erwartung liegt
Das Land und als in heißen Tagen
Herabgesenkt, umschattet heut,
Ihr Sehnenden! uns ahnungsvoll ein Himmel 3).
Voll ist er von Verheißungen und scheint
Mir drohend auch, doch will ich bei ihm bleiben (II, 157)
Diese Adventssehnsucht, wie sie hier in der Hymne ‚Germanien’ sich ausspricht, dieses eschatologische Hoffen war auch im 18. Jahrhundert lebendig. Die Freunde Hölderlin, Hegel und Schelling begeisterten sich in ihrer gemeinsamen Stube im Tübinger Stift an der Idee vom Reiche Gottes, wie sie sie in der im letzten Jahr ihres Zusammenseins, 1783, erschienenen Kantischen Schrift über ‚Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft’ nachlesen konnten.
Die Nähe Gottes – das ist die Situation des Sehers, auch des Sehers auf Patmos, dem Gott die Schrift diktiert wie dem Dichter den Gesang. Und der Dichter gibt wie ein Priester die Botschaft Gottes an die Menschen weiter. So ist er Vorbote der Zeitenwende, Seher und Künder, dass das Rettende bald da ist. In der Ode ‚Rousseau’ wird er mit dem Adler 4)verglichen:
Und fliegt, der kühne Geist, wie Adler den
°°°Gewittern, weissagend seinen
°°°°°Kommenden Göttern voraus.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Bilder für das ‚Drohende’ (‚Germanien’), für die Gefahr 5), die mit der Nähe Gottes verbunden ist:
Der Blitz Gottes, der tötend und fruchtbar zugleich ist, das Licht Gottes, das so hell strahlt, dass der, der es anschaut, erblinden würde. Die Menschen sind für die Erfahrung Gottes nicht stark genug (8. Strophe von ‚Brod und Wein’):
Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß
Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten
Freuden
Gott zu fassen, dazu bedarf es des schweren Ringens, wie Jakob mit Gott rang: „Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und mein Leben ist doch erhalten geblieben.“ (Gen 32,31) Nach dem ersten Ausbruch seines Wahnsinns schreibt Hölderlin: „Wie man Helden nachspricht, kann man wohl sagen, dass mich Apollo 6) geschlagen.“
Das Rettende wächst im Menschen, der Kräfte in sich hat, das Licht Gottes zu bestehen, der fähig ist, der Sonne zuzufliegen, auch wenn er im Finstern wohnt. Es ist die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott, die den Menschen befähigt, das Gefährliche im Nahen Gottes zu bestehen. Von Plotin beeinflusst formuliert beispielweise Goethe:
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken,
Läg’ nicht in uns des Gottes eigene Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken.
So können die Menschen, insbesondere die Dichter, ‚furchtlos’ über den Abgrund ‚Gott’ weggehen 7) und Gott begegnen.
Im Finstern wohnen
Die Adler und furchtlos gehn
Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg
Auf leichtgebaueten Brüken.
In der Ode ‚Heidelberg’ heißt es von der Brücke, dass sie sich „leicht und kräftig“ über den Strom schwingt, das heißt über die fließende Zeit, und dass sie „von Wagen und Menschen tönt“ – die Brücke als Ort der verbindenden Harmonie.
Wie von Göttern gesandt, fesselt ein Zauber einst
Auf der Brüke mich an, da ich vorüber gieng
Und herein in die Berge
Mir die reizende Ferne schien, (II,14)
Der Zauber der Brücke ist die Vision des Reiches Gottes auf Erden, wenn Götter und Menschen vereint sind. Mit „reizende Ferne“ ist das Überirdische gemeint, das zum Irdischen kommt, das Ewige, das mit der Zeit sich verbindet. Der Abgrund ist überwunden.
Auf der einen Seite die Finsternis, die Irdischkeit der Menschen, die darum „Söhne der Alpen“ heißen, Söhne der Gipfel der Zeit, der im Raum getrenntesten Berge. Die Alpen, die Berge, die Gipfel werden zu Symbolen des Raum- und Zeithabens der Menschen und damit der Geschiedenheit des Dasein, der Vereinzelung und Vereinsamung. Die Täler, in denen der Mensch wohnt, sind durch Bergeszüge voneinander getrennt, die Almen auf den Gipfeln stehen jede für sich. So lebt der Mensch ein „Dasein der Geschiedenheit“ 8), jeder ist für sich, in seinem Wesen unverstanden, nie zu verstehen, einsam. Aus dem Simul des Schöpfungsaugenblicks herausgefallen, stehen sich die Dinge voneinander getrennt gegenüber. Gegen-stände sind sie für den Menschen und er steht sich auch selbst gegenüber, durch Selbstbetrachtung innerlich zerrissen 9). Die Sprache begreift die Dinge nur von außen, nur ihre Oberfläche, nie deren Wesen. Nicht einmal sein eigenes Wesen kann der Mensch begreifen; er begreift sich selbst ebenfalls nur von außen her. Jede begriffliche Erkenntnis von Wahrheit ist unmöglich, weil die Begriffe nur die Oberfläche begreifen. Wo Gott und Mensch vereint sind, in der Kindheit, auch in der Kindheit der Menschheit, die Hölderlin im klassischen Griechenland sah, einer Kindheit, die mit der Himmelfahrt Christi beendet ist 10), da ist keine trennende Sprache 11). In ‚Da ich ein Knabe war’ spricht der Dichter die Götter an:
Zwar damals rief ich noch nicht
Euch mit Namen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen,
Als kennten sie sich.
Doch kannt ich euch besser,
Als ich je die Menschen gekannt,
Ich verstand die Stille des Äthers,
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Dieses Zurück zur Kindheit 12) ist Ausdruck der Sehnsucht nach dem natürlichen Zustand des Menschen:
Mich erzog der Wohllaut
Des säuselnden Hains,
Und lieben lernt ich
Unter den Blumen.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.
„Und voll von Blumen der Garten,/Ein stilles Feuer“ heißt es in der Vision der Wiederkunft der Götter in der Patmoshymne (3. Strophe) 13). Die „Kraft aus heiliger Schrift“ ist „Stillleuchtend“, (Strophe 13); der „stille Blick“ Gottes spiegelt sich im Blick des Sehers. In Strophe 14 heißt es: „Still ist sein Zeichen/Am donnernden Himmel“ 14).
Ursache für das Herausfallen aus der Einheit mit den Göttern ist nicht ein schuldhafter Sündenfall („Nichts ists, das Böse“ – Madonnenhymne; „Denn nichts ist gemein“ – Patmos), sondern - tragische - Notwendigkeit: der Mensch musste aus der Einheit des Simul heraus, um fühlen und lieben zu können. Im Zustand des ‚Eins mit allem was ist’ gibt es kein Bewusstsein von Objekten, weil man ja vereint ist mit allem, was ist
15), keine Liebe, weil Liebe immer das Bewusstsein von Gegenüber voraussetzt. Rheinhymne:
Denn weil
Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muß wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Teilnehmend fühlen ein Andrer,
Den brauchen sie;16)
Deshalb gehört zur Vision Hölderlins ja auch, für die neue Erde sowohl Geschichtlichkeit, Zeitlichkeit als auch Ewigkeit zugleich zu erhalten, dass es ein Zugleich von Sprache und Stille gibt 17).
Dass der Mensch als individuelle Gestalt lebt auf Erden, ist nicht seine Schuld und nicht Wille der Götter, sondern Schicksal 18), ἀνάγκη, der selbst die Götter unterworfen sind 19):
Denn sie nicht walten, es waltet aber
Unsterblicher Schiksaal und es wandelt ihr Werk
Von selbst, und eilend geht es zu Ende. 20)
Ein tragisches Geschick bestimmt die Menschen, sich aus der Einheit in Gott zu lösen und zu individuellen Gestalten im Raum zu werden. Das aber ist die Zeit der Götterferne, die zwar eilend zu Ende geht – sie dauert nur eine kleine Weile, aber doch hart genug ist, denn „Kontur ist Grenze, Charakter Unterscheidung, die Grenze wird zur Trennung, der Unterschied zur Zerreißung.“ 21), und so leben die Menschen auf „getrenntesten Bergen“ 22). Das Dasein, tragisch, ohne Schuld in diese Vereinzelung, Vereinsamung, Zerreißung geraten, hat also ein gutes Recht zu zürnen: „das Zürnen der Welt“, heißt es gegen Schluss der 6. Strophe 23).
Aus dieser Tragik wird die Welt auch nicht durch Christi Tod erlöst, sie wird nur vertröstet auf das Reich Gottes. Im Gegenteil: durch Christi Tod und dann durch Christi Himmelfahrt beginnt erst die Nacht der Götterferne, muss sie beginnen.
Hölderlin beschreibt auch Auswege aus diesem tragischen Dilemma. Ein Ausweg: Dem Abgrund zu zu stürzen, wo alles eins und selig in sich selbst ist, dem Simul zu, aus dem das Dasein herkommt; ein Weg also zurück.
Der frühe Hölderlin kennt diese Lösung noch, doch er erkennt schließlich, dass auf diesem Weg das Dasein nicht errettet wird: es müsste sich notwendig aus dieser seligen Einheit mit Gott lösen, um sich und andere fühlen zu können. In der Rheinhymne will der Rhein zuerst nach Osten fließen, dem kürzesten Weg dem Abgrund, dem Ursprung zu 24), aber er wird daran gehindert und fließt nun nach Norden durch die Zeit hindurch.
Eine zweite Rettung vor der Geschiedenheit des Daseins ist die Berauschung, die die Grenzen aufhebt; hier wird Dionysos angerufen.
Die dritte Rettung ist die christliche Gemeinschaft im Gedächtnis des Herrn, ausharrend in der Zeit, ersehnend das Reich Gottes.
Das Symbol der Alpen ist bei Hölderlin vielschichtig; die Alpen bedeuten nicht nur das Raum- und Zeithaben der Menschen und damit die Vereinzelung des Dasein. Sie sind auch die Treppe, auf der die Götter zu den Menschen steigen (vgl. Eingangsstrophe der Rheinhymne). Der Seher lebt auf dieser Treppe, um von der Ankunft Gottes zu künden.
Die Alpen sind auch der Ursprung der Ströme, des Fließenden als Zeichen der Zeit, des Werdens und Vergehens, das irdisches Dasein auszeichnet, das aus dem Simul des ewigen Eins ins Nebeneinander im Raum und Hintereinander in der Zeit projiziert wird.
Manche Interpreten verstehen die Gipfel der Zeit als die Dichter, Seher, Propheten, die Gott näher sind als andere 25). Es sind die Heroen und Halbgötter, die das Kommen der Götter vorbereiten, denen zum Gedächtnis ein Wegkreuz gesetzt ist (Mnemosyne, II, 203).
Nah ist der Gott, nah ist die Zeit, in der Gott sein Zelt unter den Menschen aufschlagen wird 26). Der Dichter erfleht sie noch einmal herbei, die Zeit, in der die Grenzen zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen fallen, in der sich alle verstehen und lieben, wo die Treue herrscht und kein Missverständnis mehr ist und kein Krieg, in der die getrenntesten Berge verbunden sind. Dies bewirkt das „unschuldig Wasser“ 27), Symbol des ewigen Lebens, das nicht wie ein Strom hinfließt, sondern sich in sich selbst bewegt wie das Meer in seiner Stille, ein Symbol der Ewigkeit. Johannes, Offenbarung 21,6: „Ich will den Dürstenden umsonst vom Quell des Lebenswasser geben.“
„So gieb unschuldig Wasser“
ist die Bitte an den Vater um „die Fluten des Himmels“, die die Täler füllen und die Gipfel verbinden, die für die Menschen ein Bad der Widergeburt werden, ihnen die Unschuld zurückgeben.
Im Fragment ‚An Diotima heißt es:
Aber vorübergerauscht sind nun die Fluten des Himmels
°°°Und geläutert, verjüngt
Geht mit den seligen Kindern hervor die Erd aus dem Bade.
°°°Froher lebendiger
Glänzt im Haine das Grün, und goldner funkeln die Blumen,
°°°...
Weiß, wie die Herde, die in den Strom der Schäfer geworfen,
Element des Verbindens, der Überwindung der Vereinzelung, der Stiftung der Gemeinschaft, in der Gott unter den Menschen wohnt, ist auch die Luft (Vater Äther), die die Fittige trägt, Mittel der Gnade Gottes:
lange haben
Das Schikliche wir gesucht,
Nicht ohne Schwingen mag
Zum nächsten einer greifen
Geradezu
Und kommen auf die andere Seite. (‚Der Isther’)
Dem Gebet ‚gieb unschuldig Wasser’ folgt in Strophe 2 und 3 die Vision der Erfüllung dieses Gebets: Asia, durch das Enjambement zu Beginn der neuen Strophe in besonderer Weise hervorgehoben, als Bild des Reiches Gottes, des Neuen Jerusalems, „eines neuen Himmels und einer neuen Erde“ 28), wo Gott wieder unter den Menschen wohnt.
Die Heimat wird zu Beginn der Vision in dämmerndem Zwielicht zurückgelassen – das Vergessen der Welt mit ihrer Sehnsucht ist Voraussetzung für die Vision. „Viel aber haben wir mitgelitten, viele Male.“ (II,188) fügt Hölderlin in einer späteren Fassung hier ein; Das Leiden verstärkt die Sehnsucht nach dem Ursprung, dem Ozean der Ewigkeit, nach dem die Bäche sich sehnen – in einer früheren Fassung (b) heißt es statt ‚Bäche’ noch ‚Wasser’, was eher Ruhe und Stille, also Ewiges assoziieren lässt. Dem Irdischen muss der Seher entrückt werden, wenn er den Himmel offen sehen will. Durch die Verrückung in die Ferne – Asia – und in die Vergangenheit – die Zeit Christi – werden Raum und Zeit aufgehoben.
‚Gold’ ist schon seit ältesten Zeiten Symbol einer erfüllten Zeit gewesen – aurea aetas. Johannes schreibt über das Neue Jerusalem: „Die Stadt selbst ist gebaut aus reinem Gold, ähnlich reinem Glas.“ Das reine Glas weist hin auf Klarheit, Durchsichtigkeit, Unverborgenheit. Die glänzende Stadt liegt „in der Klarheit Gottes“ 29). „Sie funkelte wie ein Edelstein, wie Japisstein, wie ein Kristall ... Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln.“ Hölderlin spricht von „Frischem Glanz“, vom Glanz des Taus, in dem die aufgehende Sonne sich spiegelt. Noch ist sie hinter den aufsteigenden Nebeln des Tals verborgen, geheimnisvoll, 30) doch färbt sie diesen schon golden. Dieser ‚goldene Rauch’ ist Sinnbild für die griechischen Sagen, die Heiligen Schriften, die, wenn und weil sie gelesen werden, zum Neuen Jerusalem hinführen.
Doch dann naht schnell der helle Tag, er blüht auf mit steigender Sonne; die Blumen, die in der Nacht, der Nacht der Götterferne ihre Blüten geschlossen hielten, entfalten sich 31).
Statt „Mit tausend Gipfeln duftend“ als Charakterisierung Asias heißt es in den zwei späteren Fassungen: „von tausend Tischen duftend“. Assoziiert wird die Gemeinschaft von Menschen und Göttern beim Mahl am Tag der Erfüllung 32).
„Geblendet“ ist der Seher von der „ungewohnten“ Herrlichkeit der Vision. Zum Bild des Glanzes gehört auch der goldführende Fluss Paktol, der Fluss, der Krösus reich gemacht hat, ein Nebenfluss des Hermos in Lydien, auf dem Tmolus entspringend. Die Landschaft, die Hölderlin beschreibt, ist auch die, in der die sieben Gemeinden lagen, an die Johannes schreibt. Im ‚Hyperion’, zu einer Zeit also, in der Hölderlin das, was er jetzt als Vision und nahe Zukunft vor sich sieht, die Erfüllung der Zeit, im Asia, im Griechenland der Zeit vor 2500 Jahren suchen wollte, schreibt er: „Ich hatte am Fuß des Bergs übernachtet (gemeint ist der Tmolus) in einer freundlichen Hütte, unter Myrten, unter den Düften des Ladanstrauchs, wo in der goldenen Flut des Paktolos die Schwäne mir zur Seite spielten (I,1,6 S.21).
In der Ode ‚Der Neckar’ heißt es 33):
Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht
°°°Verlangend nach den Reizen der Erde mir,
°°°°°Zum goldenen Paktol, zu Smyrnas
°°°°°°°Ufer, zu Ilions Wald. ...
Mit Taurus und Messogis, zwei Höhenzüge Kleinasiens, ist wohl das ganze Kleinasien umschrieben als Wohnung der Götter; ein abgeschlossener, genau umgrenzter Raum muss es sein. So ist auch oft ein Saal Symbol der Anwesenheit des Göttlichen, wie es zu Beginn der ‚Friedensfeier’ heißt:
Der himmlischen, still wiederklingenden,
Der ruhigwandelnden Töne voll,
Und gelüftet ist der altgebaute,
Seeliggewohnte Saal; um grüne Teppiche duftet
Die Freudenwolk' und weithinglänzend stehn,
Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche,
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe,
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem
Geebneten Boden die Tische.
Die Vorstellung von der Wohnung der Götter als einem durch die beiden eingrenzenden Gebirgszüge genau abgemessenen, in sich geschlossenen, durch Gassen und Säulen geordneten Raum entspricht der Vision des Neuen Jerusalems bei Johannes. In der Patmos-Hymne ist mit den „göttlichgebauten Pallästen“, „getragen ... Von lebenden Säulen“ - eine Naturkulisse verstanden als Tempel 34) -, und mit den duftenden tausend Tischen Asia der abgezirkelte Bereich, in sich abgeschlossen und ausgezeichnet durch seine vollkommene harmonische Ordnung.
„Und voll von Blumen der Garten“ ist Zeichen der Gegenwart der Götter; im Bild der natura naturata ist die natura naturans gemeint, die Mutter alles Lebenden, der Grund alles Seienden, auch die Mutter der Götter.
In dieser goldenen Zeit ist auch die Nähe der Götter nicht mehr gefahrvoll, ihre Glut nicht mehr verbrennend, sondern erwärmend, Liebe weckend, „ein stilles Feuer“ wie die feurig glänzenden Blumen des Gartens.
Das Bild des Gebirgsschnees im Abglanz der rosenfingrigen Morgenröte oder schon getroffen von den ersten Strahlen der Sonne hat Hölderlin immer verwendet, so in der Elegie ‚Heimkunft’ 35):
so in der Elegie: Heimkunft 35):
Ruhig glänzen indes die silbernen Höhen darüber,
Voll mit Rosen ist schon droben der leuchtende Schnee. (II,100)
An seine Bruder schreibt Hölderlin aus Hauptwil („Ich fühle es“...“): „Hier in dieser Unschuld des Lebens, hier unter den silbernen Alpen“.
Zum Motiv der Unschuld 36) kommt das der Unsterblichkeit: Ihr wie auch des Todes Symbol ist der Efeu, das Gewächs des Dionysos.
Und Zeug unsterblichen Lebens
An unzugangbaren Wänden
Uralt der Epheu wächst
„Unzugangbar“ ist das unsterbliche Leben jener Vision. Hölderlin spricht aus einem Augenblick kurz vor der Erfüllung; wenn er Zugang zum Neuen Jerusalem gehabt hätte, hätte die Erfüllung ihn verstummen lassen, die Sprache könnte das Einssein mit dem Göttlichen nicht fassen.
Strophe 4 - 6
Es rauschen aber um Asias Thore
Hinziehend da und dort
In ungewisser Meeresebene
Der schattenlosen Straßen genug,
Doch kennt die Inseln der Schiffer.
Und da ich hörte
Der nahegelegenen eine
Sei Patmos,
Verlangte mich sehr,
Dort einzukehren und dort
Der dunkeln Grotte zu nahn.
Denn nicht, wie Cypros,
Die quellenreiche, oder
Der anderen eine
Wohnt herrlich Patmos,
Gastfreundlich aber ist
Im ärmeren Hauße
Sie dennoch
Und wenn vom Schiffbruch oder klagend
Um die Heimath oder
Den abgeschiedenen Freund
Ihr nahet einer
Der Fremden, hört sie es gern, und ihre Kinder
Die Stimmen des heißen Hains,
Und wo der Sand fällt, und sich spaltet
Des Feldes Fläche, die Laute
Sie hören ihn und liebend tönt
Es wieder von den Klagen des Manns. So pflegte
Sie einst des gottgeliebten,
Des Sehers, der in seeliger Jugend war
Gegangen mit
Dem Sohne des Höchsten, unzertrennlich, denn
Es liebte der Gewittertragende die Einfalt
Des Jüngers und es sahe der achtsame Mann
Das Angesicht des Gottes genau,
Da, beim Geheimnisse des Weinstoks, sie
Zusammensaßen, zu der Stunde des Gastmals,
Und in der großen Seele, ruhigahnend den Tod
Aussprach der Herr und die lezte Liebe, denn nie genug
Hatt' er von Güte zu sagen
Der Worte, damals, und zu erheitern, da
Ers sahe, das Zürnen der Welt.
Denn alles ist gut. Drauf starb er. Vieles wäre
Zu sagen davon. Und es sahn ihn, wie er siegend blikte
Den Freudigsten die Freunde noch zulezt,
Die Vision des offenen Himmels ist etwas Blendendes, Ungewohntes; und der Dichter sucht den, der ihm verwandt ist in seiner Nähe zu Gott, der ihm vertraut ist, „eines, das ich kennete“: Johannes.
So ist die zweite Triade der Hymne der Insel Patmos gewidmet, einem herausgehobenen, abgeschlossenen Ort, auf dem sich Göttliches ereignen kann, auf dem Johannes Gott nahe kommt, wie der Dichter am Paktolfluss Gott nahe war.
Patmos „wohnt herrlich“; der Ausdruck ist zunächst als Gräzismus zu verstehen, da im Griechischen ‚wohnen’ und ‚liegen, gelegen sein’ mit demselben Wort benannt werden. ‚Wohnen’ bedeutet aber auch, dass Patmos „nicht wie etwas Totes da ist, sondern anwesend, daseinsmächtig, lebendig herwirkend“ 37). Zwar äußerlich ärmer, herber als das prächtige, verschwenderische, quellenreiche heidnische Cypros 38), doch auch herrlich, denn innerlich reicher, voller Mitgefühl und Trost und antwortender Liebe auf die Klage des Menschen in götterferne Nacht: das Wesen des Christentums.
In der harten Fügung des späten Hölderlins wird ein anschauliches Bild gezeichnet: „die Stimmen des heißen Hains“, das sind die „felsenbewohnenden Lüfte“, wie es in einer früheren Niederschrift heißt, Winde, die in der Dürre den Sand aufwirbeln und niederfallen lassen. Die Laute, die dort entstehen, „wo der Sand fällt, und sich spaltet/Des Feldes Fläche“ durch Hitze und Dürre, werden im Fragment von ‚Hyperion’ „ein leises Ächzen der Erde“ genannt, „wenn der brennende Strahl den Boden spaltet“. Diese Laute, das Sausen des Sandsturms und das Ächzen der verdörrten Erde sind die Kinder der Insel und Echo auf die Klage des Johannes.
Zu dieser Insel führt eine schattenlose Straße, zunächst wie immer bei Bildern Hölderlins ganz wörtlich zu verstehen als Schifffahrtsweg, der ohne Schatten ist. Selbst der Schiffsmast wirft kaum Schatten – „entlaubte Mast“ nennt Hölderlin in ‚Andenken’ 39), die ‚schattenlose Straße’, ein Gegenbild zum schattigen Wald und den sehnsuchtvollen Bächen und Hinweis auf das Bild des scharfen Strahls in Strophe 13.
Johannes – Evangelist und Jünger sind dieselbe Person - war von seinem Freund Christus verlassen und hatte so seine Heimat verloren wie einer, der Schiffbruch erlitten hat. Die Traurigkeit der Emmaus-Jünger war nicht vollständig gewichen, als sie wussten, dass Christus auferstanden war, und als dieser ihnen den heiligen Geist gesandt hatte.
Wer, wie Johannes, an der Seite Christi geruht hat, wird, wenn er dies verloren hat, um eine verlorene Heimat klagen und mit aller Inbrunst auf die Wiederkehr dieser Heimat hoffen, ein Hoffen, das sich steigert zur Vision dieser Wiederkehr.
Johannes war „in seeliger Jugend“ Christus, der nach seinen Worten „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen“ 40), von Hölderlin „der Gewittertragende“ genannt wird, sehr nahe gewesen; „es sahe der achtsame Mann/Das Angesicht des Gottes genau“ – Hölderlin denkt hier an den Anfang des Ersten Johannesbriefes: „Was von Anfang an war, was wir gehört und mit eigenen Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, es betrifft das Wort des Lebens – ja das Leben ist sichtbar erschienen und wir sahen es ... was wir gesehen und gehört haben, das tun wir euch also kund.“ Nach einem riesigen, sich über 15 Verse erstreckenden Satz, der in einer sich immer mehr steigernden Spannung einer ruhigen Begeisterung von der Liebe Christi zu Johannes und zur Welt und von seiner Todesahnung spricht, wirken die drei lakonischen Sätze
Denn alles ist gut. 41)Drauf starb er. Vieles wäre
Zu sagen davon. 42)wie ein Ruhepunkt in dieser ansonsten nur aus langen Sätzen gebauten und so immer vorwärtsdrängenden Hymne, wie ein Augenblick, in dem die Zeit stillezustehen scheint und das allein Wesentliche genannt wird.
Strophe 7 – 9
Doch trauerten sie, da nun
Es Abend worden, erstaunt,
Denn Großentschiedenes hatten in der Seele
Die Männer, aber sie liebten unter der Sonne
Das Leben und lassen wollten sie nicht
Vom Angesichte des Herrn
Und der Heimath. Eingetrieben war,
Wie Feuer im Eisen, das, und ihnen gieng
Zur Seite der Schatte des Lieben.
Drum sandt' er ihnen
Den Geist, und freilich bebte
Das Haus und die Wetter Gottes rollten
Ferndonnernd über
Die ahnenden Häupter, da, schwersinnend
Versammelt waren die Todeshelden,
Izt, da er scheidend
Noch einmal ihnen erschien.
Denn izt erlosch der Sonne Tag
Der Königliche und zerbrach
Den geradestralenden,
Den Zepter, göttlichleidend, von selbst,
Denn wiederkommen sollt es
Zu rechter Zeit. Nicht wär es gut
Gewesen, später, und schroffabbrechend, untreu,
Der Menschen Werk, und Freude war es
Von nun an,
Zu wohnen in liebender Nacht, und bewahren
In einfältigen Augen, unverwandt
Abgründe der Weisheit. Und es grünen
Tief an den Bergen auch lebendige Bilder,
Doch furchtbar ist, wie da und dort
Unendlich hin zerstreut das Lebende Gott.
Denn schon das Angesicht
Der theuern Freunde zu lassen
Und fernhin über die Berge zu gehn
Allein, wo zweifach
Erkannt, einstimmig
War himmlischer Geist; und nicht geweissagt war es, sondern
Die Loken ergriff es, gegenwärtig,
Wenn ihnen plözlich
Ferneilend zurük blikte
Der Gott und schwörend,
Damit er halte, wie an Seilen golden
Gebunden hinfort
Das Böse nennend, sie die Hände sich reichten -
Mit dem Tode Christi beginnt die Nacht der Götterferne, es beginnt die Zeit des Trauerns; der Abend des Göttertags ist gekommen, „der Sonne Tag“ ist erloschen 43). Es ist die Trauer der Emmaus-Jünger, von der die dritte Triade spricht. Dieser elegische Ton der Trauer durchzieht die gesamte Hymne, deren Sinn in einem Satz des Johannesevangeliums zusammengefasst werden kann: „Auch ihr seid jetzt traurig 44), ich werde euch aber wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird euch niemand nehmen.“ 45) Hölderlins Wort über die Jünger:
und lassen wollten sie nicht
Vom Angesichte des Herrn
nimmt Bezug auf die Apostelgeschichte: Am allermeisten betrübt über das Wort, das er sagte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen.“ 46)Diese Betrübnis lähmt ihr Wollen; das „Großentschiedene“ können sie nicht weiter verfolgen.
schwersinnend
Versammelt waren die Todeshelden 47)Im Gedenken an Christus, den sie nie vergessen werden. Immer wieder wird er sie wie ein Schatten begleiten, denn seine Gestalt war in sie „eingetrieben“, so wie Feuer selbst in das harte Eisen dringt und es zum Glühen bringt 48). Noch ein letztes Mal lässt Christus am Pfingstfest seine Nähe spüren, dann beginnt endgültig die Nacht der Götterferne
Denn izt erlosch der Sonne Tag
Der Königliche 49)
Christus erlöst also die Menschen nicht von der Nacht 50), aber er stärkt sie zum Ausharren in dieser Nacht, die mit seinem Weggang beginnt, indem er die tröstliche Hoffnung auf seine Wiederkehr hinterlässt. Christus kann also das Zürnen der Welt nicht versöhnen, er kann es „erheitern“; und nicht einmal das – in einer späteren Fassung heißt es: „und zu schweigen, da/Ers sahe, das Zürnen der Welt.“ 51)„Es erlosch die Freude der Augen mit ihm“ 52)
An dem am meisten
Die Schönheit hieng 53)
In der Nacht der Götterferne ist das Anschauen der Schönheit ersetzt durch kontemplatives Sich-Erinnern und durch das Vorausschauen der Wiederkehr, das dem einfältigen Auge 54) möglich ist und Trost spendet:
und Freude war es
Von nun an,
Zu wohnen in liebender Nacht, und bewahren
In einfältigen Augen, unverwandt
Abgründe der Weisheit.
So ist das Erdendasein in der Nacht der Götterferne doch nicht völlig kalt und tot; es bleibt lebendig in der Erinnerung an den, der von sich sagt, dass er das Leben sei.Und es grünen
Tief an den Bergen auch lebendige Bilder
In der „dunkeln Grotte“ der Insel Patmos – „tief an den Bergen“, im dunklen Tal der Götterferne - schreibt der Seher Johannes seine Weisheit, seine „lebendigen Bilder“. In einer ersten Niederschrift hieß die entsprechende Stelle: „Zwar/Es leuchten auch im Dunkel blühende Bilder“.
Exkurs: Christus und die griechischen Götter
In einem Entwurf zur 8. Strophe heißt es: Christus zerbrach „Den Zepter, womit Er hatte geherrscht von Asia her Seit unerforschlichen Zeiten.“ 55) Er ist also der Letzte des Göttergeschlechts, wie Hölderlin in ‚Der Einzige’ sagt:
Viel hab ich Schönes gesehn,
Und gesungen Gottes Bild
Hab ich, das lebet unter
Den Menschen, aber dennoch,
Ihr alten Götter und all
Ihr tapfern Söhne der Götter,
Noch Einen such ich, den
Ich liebe unter euch,
Wo ihr den letzten eures Geschlechts,
Des Hauses Kleinod mir
Dem fremden Gaste verberget.
Von Christus als der letzte in einer Reihe von Göttern und Halbgöttern spricht auch die Elegie ‚Brod und Wein’
Nemlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange,
Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt,
Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,
Und das Trauern mit Recht über der Erde begann,
Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch
Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet' und schwand,
Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder
Käme, der himmlische Chor einige Gaaben zurük,
Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu freuen vermöchten,
Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß
Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten
Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank.
Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte geseegnet,
Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.
Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit,
Vor allem mit Herakles und Dionysos vergleicht Hölderlin Christus, Halbgötter wie er, Mittler zwischen Gott und Menschen – das Kleeblatt nennt er die drei. Zwar scheut Hölderlin sich zeitweise, die ‚weltlichen’ Göttersöhne mit Christus zu vergleichen, Christus sei der ‚Andere’; doch er hält auch seine Scheu für unbegründet, da sie ja alle den gleichen Vater haben, und so muss er als ‚geistiger’, d. h. für Hölderlin ‚geistlicher’ 56) Dichter auch die ‚weltlichen’ Götter besingen.
Die Dichter müssen auch
die geistigen weltlich sein.
Götter waren für die Griechen Gestalt gewordener Ausdruck für das Erspüren von numinosen Mächten, die sich in der Welt ereignen wie die Liebe, wie Naturgewalten und Naturschönheit, Mächte, die aus dem Grund der Welt, aus der Natur (natura naturans) hervorgehen.
Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten
Und über die Götter des Abends und Orients ist,
Die Natur 57)
Umgekehrt weisen die numinosen Mächte auf das eine Göttliche hin, sind also Offenbarung des einen Gottes, der dadurch nicht auf eine abstrakte metaphysische Größe, auf ein Philosophisch-Absolutes eingeschränkt ist.
-------------------------------------------------------------------------------------
Denn izt erlosch der Sonne Tag
Der Königliche und zerbrach
Den geradestralenden,
Den Zepter, göttlichleidend, von selbst,
Denn wiederkommen sollt es(,)
Zu rechter Zeit.
In der Stuttgarter Ausgabe ist hinter ‚Denn wiederkommen sollt es’ ein Komma gesetzt, wird also als Parenthese verstanden und ‚zu rechter Zeit’ auf ‚erlosch’ und ‚zerbrach’ bezogen.
Zur rechten Zeit nimmt Christus sein Sterben auf sich, vollzieht so die schicksalhafte Trennung zwischen Göttern und Menschen 58).
Nicht wär es gut
Gewesen, später, und schroffabbrechend, untreu,
Der Menschen Werk
das „untreu“, gegen das Weltgesetz, nach dem notwendig einer Einheit im ewigen Ursprung (These) einer Trennung in der Zeit (Antithese) und die Synthese von Zeit und Ewigkeit folgt, die Einheit hätte bewahren wollen, bis das Schicksal gewaltsam die Trennung vollzogen hätte. Diese Trennung aber muss sein, weil nur durch sie im Reich Gottes eine Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen entsteht, in der jedes in seinem Eigenen bestehen bleibt, das eine im anderen aufgehoben ist. Erst durch die bleibende Erfahrung der Trennung kann der Mensch das Glück des Göttertags voll empfinden und auch das Göttliche kann sich erst fühlen, indem der Mensch in seiner Besonderheit mit aufgehoben ist in dieser Einheit. Wenn Christus stirbt, beginnt die Zeit der Trennung, und durch seinen Tod und durch seine Verkündigung sichert er das Kommen des Reiches Gottes, stiftet ein Gedächtnis derer, die auf sein Wiederkunft hoffen; und so ist sein Tod nicht „schroffabbrechend“ gewesen.
Die letzte Strophe der Triade, die den Jüngern gewidmet ist, gibt ein Bild der beiden Hälften des Lebens, das die Jünger nun verbringen: leben in der liebende Gemeinschaft, die sich bildet in Erinnerung und Erwartung des Herrn – Himmelfahrt bzw. Pfingsten war der Tag, an dem sie sich zu dieser Gemeinschaft zusammenschlossen - und trauernd leben in götterferner Nacht, in der Zerstreuung im Getrenntsein voneinander, in der Einsamkeit, nachdem sie „fernhin über die Berge“ – Räume der Trennung - in alle Welt gegangen sind.
Doch furchtbar ist, wie da und dort
Unendlich hin zerstreut das Lebende Gott.
So beginnt die 9. Strophe und sie endet in einer Steigerung zum Freundlichen hin mit der liebenden Gemeinschaft wie an Seilen golden/Gebunden.
Hölderlin hat den Bericht aus der Apostelgeschichte im Sinn: „An jenem Tage aber brach eine große Verfolgung gegen die Kirche in Jerusalem aus. Alle mit Ausnahme der Apostel wurden zerstreut in die Landstriche von Judäa und Samaria.“ 59)
Das war der Beginn der Zerstreuung in die Einsamkeit, deren Höhepunkt im Bild der getrenntesten Berge (1. Strophe) dargestellt wurde zugleich mit Bildern der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zerstreuung. Diese ist „furchtbar“ und zerstörend. In einer Vorstufe zu einer späteren Fassung heißt es: „Doch furchtbar wahrhaft ists, wie 60) da und dort/Unendlich hin zerstört das Lebende Gott.“ Gott zerstört, weil zu dieser Zerstreuung in die Nacht der Götterferne auch der Martyrertod der „Todeshelden“ gehört. Furchtbar ist dieses Ereignis, weil die Jünger sich in ihrer Zerstreuung noch erinnern an die Liebesgemeinschaft – in einer Vorstufe heißt es ‚Liebende’ statt Lebende’ – im Gedächtnis Christi, den sie gemeinsam, „zweifach/erkannt“ hatten; die Zweisamkeit der Emmausjünger bedeutet auch, dass die Erkenntnis des Göttlichen kein leeres Hirngespinst war, „nicht ein bloßer Traum des Einzelnen, sondern eine auch von anderen erfahrene und bestätigte Wirklichkeit und Tatsache“ 61). Diese gemeinsame Erkenntnis aber hatten sie „einstimmig“, zu einer innigen Gemeinschaft zusammengeschlossen, gemacht. Das Bild der ergriffenen Locken besagt Ähnliches wie das ‚zweifach’: Die Gestalt Christi war keine Weissagung für die Zukunft gewesen, keine Utopie und kein Traum, sondern gegenwärtige, greifbare Wirklichkeit, von der die Jünger selbst mächtig ergriffen waren, entsprechend eines Bildes aus dem Buch des Propheten Ezechiel: „Er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei der Locke meines Hauptes.“ 62) In der ‚Ilias’ „fasste Athene Achill an seinen goldenen Locken“ 63) um den Streit zwischen diesem und Agamemnon zu schlichten.
Die Loken ergriff es
Da hatten die Männer sich geschworen, eine Gemeinschaft zu gründen, die – durch die Liebe Christi – wie mit goldenen Seilen zusammengebunden war 64), die sich wehrte gegen die Vereinzelung, gegen die Zerstreuung, indem sie dieses Böse aussprach und somit bannte.
So festigt sich nach der Himmelfahrt Christi eine Gemeinschaft,
schwörend,
Damit er halte
Weil diese Gemeinschaft - die Kirche Christi - im Gedächtnis des Herrn sich vereinigt, so beim Abendmahl (siehe ‚Brod und Wein’), ist Christus mitten unter ihnen; so können sie, „die zusammenlebten/Im Gedächtniß“ 65) den „Ferneilenden“, der ein letztes Mal zurück blickt, beschwörend halten.
Strophe 10 – 12
Wenn aber stirbt alsdenn
An dem am meisten
Die Schönheit hieng, daß an der Gestalt
Ein Wunder war und die Himmlischen gedeutet
Auf ihn, und wenn, ein Räthsel ewig füreinander
Sie sich nicht fassen können
Einander, die zusammenlebten
Im Gedächtniß, und nicht den Sand nur oder
Die Weiden es hinwegnimmt und die Tempel
Ergreifft, wenn die Ehre
Des Halbgotts und der Seinen
Verweht und selber sein Angesicht
Der Höchste wendet
Darob, daß nirgend ein
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehn ist oder
Auf grüner Erde, was ist diß?
Es ist der Wurf des Säemanns, wenn er faßt
Mit der Schaufel den Waizen,
Und wirft, dem Klaren zu, ihn schwingend über die Tenne.
Ihm fällt die Schaale vor den Füßen, aber
Ans Ende kommet das Korn,
Und nicht ein Übel ists, wenn einiges
Verloren gehet und von der Rede
Verhallet der lebendige Laut,
Denn göttliches Werk auch gleichet dem unsern,
Nicht alles will der Höchste zumal.
Zwar Eisen träget der Schacht,
Und glühende Harze der Aetna,
So hätt' ich Reichtum,
Ein Bild zu bilden, und ähnlich
Zu schaun, wie er gewesen, den Christ,
Wenn aber einer spornte sich selbst,
Und traurig redend, unterweges, da ich wehrlos wäre
Mich überfiele, daß ich staunt' und von dem Gotte
Das Bild nachahmen möcht' ein Knecht -
Im Zorne sichtbar sah' ich einmal
Des Himmels Herrn, nicht, daß ich seyn sollt etwas, sondern
Zu lernen. Gütig sind sie, ihr Verhaßtestes aber ist,
So lange sie herrschen, das Falsche, und es gilt
Dann Menschliches unter Menschen nicht mehr.
Denn sie nicht walten, es waltet aber
Unsterblicher Schiksaal und es wandelt ihr Werk
Von selbst, und eilend geht es zu Ende.
Wenn nemlich höher gehet himmlischer
Triumphgang, wird genennet, der Sonne gleich
Von Starken der frohlokende Sohn des Höchsten,
Die nächste Triade spricht von der Zeit, die sich von Christi Himmelfahrt bis heute erstreckt.
...Lang ist
Die Zeit, es ereignet sich aber
Das Wahre. 66)
Es ist die Zeit, in der
nirgend ein
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehn ist oder
Auf grüner Erde 67)Weil nicht mehr geehrt wird der letzte des Göttergeschlechts, der Halbgott Christus, auf den „die Himmlischen gedeutet“: „Dies ist mein geliebter Sohn“ 68).
Dieser Christus und die Seinen werden nicht mehr geehrt, kein Gottesdienst wird mehr gehalten, die Tempel sind zerstört durch ein Unwetter, eine alles hinwegschwemmende Flut, die auch den Sand des Ufers und die Weidenbäume 69) hinwegreißt. Die Flut der Zeit zerstört seine ihm gesetzten Ufer, wird autonom, zezerstört alles Lebende, vernichtet selbst das Gedächtnis des Göttlichen.
70).szerstört alles Lebende, vernichtet selbst das Gedächtnis des Göttlichen. 70).tört alles Lebende, vernichtet selbst das Gedächtnis des Göttlichen. 70).
Wenn aber stirbt alsdenn
An dem am meisten
Die Schönheit hieng
kann auch die Gemeinschaft im Gedächtnis an ihn nicht bestehen - „ein Räthsel ewig füreinander“, sie können sich nicht mehr fassen, nicht mehr die Hände sich reichen.
Dieser Vision einer durch das Schicksal herbeigeführten 71) götterleeren Zeit folgt die Frage nach dem Sinn einer solchen Gottferne.
daß nirgend ein
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehn ist oder
Auf grüner Erde, was ist diß? 72)
Diese drei letzten Verse der Strophe 10 sind der Gipfel einer sprachlich-syntkaktischen-rhythmischen Steigerung, die mit „Doch furchtbar ist“ (Strophe 9) einsetzt, mit „Wenn aber stirbt alsdenn“ sich fortsetzt und nach einem letzten Atemholen ihre äußerste Spannung erreicht in der Frage „was ist diß?“ Dann löst sich die Spannung in den feierlichen Worten „Es ist der Wurf des Säemanns“ – eine Komposition von großer künstlerischer Kraft.
Das Bild des Worflers findet sich häufig im Alten Testament. Matthäus und Lukas greifen es auf und lassen Johannes, den Prediger in der Wüste, Christus mit dem Sämann vergleichen.73): Die Wurfschaufel hat er in der Hand und wird seine Tenne reinigen, den Weizen wird er in seine Scheune sammeln, die Spreu aber in unauslöschlichem Feuer verbrennen.“ – das Gericht am Ende der Welt. Das Bild vom unauslöschlichen Feuer greift Hölderlin nicht auf. Der Wurf des Sämanns ist für ihn ein Bild der Zeit zwischen dem Ende des antiken Göttertages und der Wiederkunft Christi. Diese Zwischenzeit ist vom Schicksal dazu bestimmt, dass alles ins „Klare“ 74) kommt, dass Götter und Menschen vereint sind, ohne dass die trennenden Konturen verwischt werden. Dazu muss die unterschiedlose und damit fühllose Einheit verlassen werden und der Mensch muss sein Eigenes erfahren in der Trennung.
In dieser notwendigen Trennung gibt es die Spreu, die tragischen Verfehlungen in götterloser Zeit. „Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Heiligtum heißt, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt“ (2. Thess. 2,3ff) oder der aus dem „Eisen“ des Schachts und den „glühenden Harzen“ des Ätna 75) „ein Bild“ von Gott „bilden“, durch den „Reichtum“ des Dichters, seine schöpferische Kraft die Wiederkehr der Götter erzwingen, voreilig die Wiederkunft Christi beschwören will. Aus diesen Mitteln die Gestalt des Gottes bilden zu wollen, hieße, Gott zum Geschöpf des Menschen zu erniedrigen. 76)
Das wäre titanisch, das wäre die Hybris des Menschen, die Schuld des genialen Dichters, der doch „rein“ und „schuldlos“ sein müsste. Nicht darf der Dichter sich selbst anspornen, sondern er muss warten, bis die Zeit gereift ist, der Wurf zuende, die Spreu herausgefallen. Die Zeit, in der das Wort Gottes wieder gehört wird und ebenso das Wort des Dichters, kann nicht erzwungen werden, wie auch der Herr der Zeiten wartet, bis die Zeit reif ist 77): „Nicht alles will der Höchste zumal“ 78) In der Hymne ‚Der Einzige’ heißt es: „Ein Gott weiß aber,/Wenn kommet ... das Beste“. Stolz, Anmaßung wäre es, selber ein „Herrscher mit Sporen“ 79) sein zu wollen. 80)
Seminararbeit
Hölderlin
Patmos
DEM LANDGRAFEN VON HOMBURG
Strophe l0 - 14
Wenn aber stirbt alsdenn,
Christus beendete, dem Geschick folgend, den Göttertag zu rechter Zeit und entließ die Menschen, die reif geworden waren, in die Mündigkeit, damit sie, den Strom der Zeit durchlaufend, zu einer dauerhaften Klarheit gelangen, zu einem zweiten, vollendeteren Göttertag.( 8. Str.). So wohnen die Menschen in der Götterferne. Doch noch lebt Christus. Zwar entzog er sich dem Blick seiner Jünger, aber als dieser Ge-wesene wendet er sich in seinem Entziehen den Menschen wieder zu als das Kommende, das eschaton.
„Das Denken an das ,Gewesene’, d.h. an das zu seiner Wesung Gekommene, ist ein Andenken eigener Art.“ (S. 9l) 1). Heidegger spricht von dem Geheimnisvollen des Andenkens, „daß es zum Gewesenen hineindenkt, daß dieses Gewesene selbst jedoch im Hineindenken zu ihm auf den Hindenkenden in der Gegenrichtung zurückkommt ..., daß das Gewesene bei seiner Rückkunft im Andenken über unsere Gegenwart sich hinausschwingt und als ein Zukünftiges auf uns zukommt“ (5.91). Damit ist aber das Eigene der christlichen Gemeinde und ihrer Endzeiterwartung gedeutet. Eschatologie ist „der notwendige Vorblick des Menschen aus seiner durch das Ereignis Christi bestimmten heilsgeschichtlichen Situation auf die endgültige Vollendung dieser seiner eigenen, schon eschatologisch bestimmten Daseinssituation. Ziel dieses Vorblickes ist es, daß der Mensch seine Gegenwart annehme als schon jetzt verborgen gegenwärtige und endgültige Zukunft, die sich gerade dann jetzt schon als Heil gibt, wenn sie angenommen wird als die ... Tat Gottes, der allein verfügt.“ 2) Dies ist ein Grundzug der paulinischen Theologie: das menschliche Werden ist ein Werden aus der Wirklichkeit Christi heraus, aus der Gnade, auf die hin sich der Mensch entwickelt in einer Metamorphose von einer Herrlichkeit zur anderen (2. Kor. 3,18). Auch der späte Hölderlin nimmt die Gegenwart auf sich als eine verborgen gegenwärtige Zukunft. Die Nacht der Götterferne ist heilige Nacht (II,49) 3), weil sie das Heilige als das Zukommende birgt. Die Nacht ist die Zeit der ge-wesenen Versöhnung und damit die Zeit der Bergung der kommenden Versöhnung. „Weil sie in solchem bergend-verbergenden Nachten nicht nichts ist, hat sie auch ihre eigene weite Klarheit und das Ruhige der stillen Bereitschaft eines Kommenden“ (1o4):
... und Freude war es
Von nun an,
Zu wohnen in liebender Nacht, und bewahren
In einfältigen Augen, unverwandt
Abgründe der Weisheit. (II,176)
Zu diesem Bewahren aber ist es dem Menschen aufgegeben zu wachen:
Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht. (II,95)
In der Zwischenzeit tönt des Wächters/Gesang (II,167), das Horn des Wächters bei Nacht (II,330). „Wohl kann die Länge dieser Nacht menschliches Vermögen zuweilen zu dem Wunsch drängen, in ein Schlafen wegzusinken“ (1o4). Von diesem Schlafen, das ein Tod ist, sagt der Beginn der l0. Strophe. Die Menschen sind nicht mehr die bewahrenden, sondern die vergessen habenden. Das Gedächtnis Christi ist tot, die „lebendigen Bilder“ gestorben, die Zukunft leer, die Gegenwart sinnlos. Was aber hat der Mensch vergessen, als er Christus vergaß,
An dem am meisten
Die Schönheit hing, daß an der Gestalt
Ein Wunder war und die Himmlischen gedeutet
Auf ihn,?
In der Hymne begegnen uns fünf Namen, Wesensbezeichnungen, deren Träger zunächst je in ihrer Funktion und in ihrem Zusammenhang dargestellt werden müssen : 1. die Sterblichen, 2. die Unsterblichen (Himmlischen), 3. Christus, der Halbgott, 4. der Vater als der Höchste, als des Himmels Herr und 5. die allversöhnende Natur.
Sterbliche und Unsterbliche, Menschen und Götter bedeuten wesentliche Gegensätze. Im Anfang der Geschichte waren diese Gegensätze versöhnt, in ihrem Ende werden sie wieder versöhnt sein, doch auf gültigere Weise. So lange Menschen und Götter versöhnt sind, geben die Götter das Licht, in dem sich die Sterblichen in ihrem Wesen erkennen. Die Götter sind die Lichtenden, die die Menschen in ihr Wesen stellen durch ihre Gegenwart. So entsprechen Götter und Menschen als versöhnte einem Gesetz; es ist das Wesensgesetz alles Lebens überhaupt, das Gesetz der Schönheit als das Gesetz der Versöhnung. Dieses Gesetz aber erscheint sichtbar in der Gestalt Christi; er wird der Schönste genannt (Ps 45,3). Seine Aufgabe war es, das Gesetz zu verkünden und zu sterben und in seinem Tode das Andenken zu erhalten an die Versöhnung. Die Götter ließen in ihrem Lichte den Menschen in seinem Wesen anwesend sein. Christus aber ist erscheinendes Zeichen der vermittelnden Lichtung, durch die überhaupt das Lichten möglich wird. Als Halbgott erstellt er das Zwischen von Göttern und Menschen. So zeigte er die Ermöglichung der Versöhnung, in der Götter und Menschen lebten. Er ist die Erfüllung, auf die Menschen und Götter, das Gesetz der Versöhnung verwirklichend, hindeuteten: der Letzte des Geschlechts der Göttersöhne. Umgekehrt wurde die Existenz der Versöhnung von Christus ebenso wie von Herakles und Dionysos gedeutet, indem in ihm das Gesetz der Versöhnung erschienen ist.
Was aber bedeutet dieses Gesetz der Versöhnung? Es ist über die Götter und Menschen, es ist ihr Herr, ihr herrschender Anfang, arché, Grund, allversöhnende Erde, Natur, Ursprung, schöpferisches Lebensprinzip (für Hölderlin synonyme Begriffe). Das Wesen dieses Grundes gilt es zu entfalten: Wenn Christus als das gestalthafte Zeichen des Grundes der Schönste genannt wird, so ist der Grund die Schönheit selbst, die im Hyperion das hen diapheron heauto (das Eine in sich selber unterschiedne) des Heraklit genannt wird (III,85). „Die Schönheit ist das ursprünglich einigende Eine“ (127). Schönheit ist der allgegenwärtige, schöpferische Grund alles Seienden, des sterblichen als auch des unsterblichen: die göttlich schöne Natur (II,122). Verkündigt wird sie als Gesetz der Versöhnung, einer Versöhnung, die im Anfang der Geschichte sich zeigte im Göttertag, dem Zeichen einer heilen Welt. Die Versöhnung der Gegensätze, der Grund der Einigkeit von Göttern und Menschen ist das Heilige, das als ge-wesenes in der Zeit der Götterferne verborgenes noch anwest als das Zukommende. Diese Einigkeit ist nun nicht ein unterschiedsloses Zusammenfallen des ehemals Gegensätzlichen, sondern sie hat dialektische Struktur. Die Gegensätze sind in der Einigkeit nicht verschwunden, sondern aufgehoben, behalten, erhöht. Diese Unterscheidung verwehen, das ist das Unreine.
Gott rein und mit Unterscheidung
Bewahren, das ist uns vertrauet, (II,261)
In Patmos heißt es:
... Nämlich rein
Zu sein, ist Geschick, ein Leben, das ein Herz hat,
Vor solchem Angesicht, (II, l90f.).
Im Angesicht des Göttlichen bedarf es der reinlichen Trennung von Sterblichen und Unsterblichen, damit das Höchste, das Heilige, das einigende Eine nicht verstellt werde, sondern offen bleibe als das Offene. Heidegger nennt dieses Heilige „das Gesetz, das in anderer Weise setzt als menschliches Gesetz“
, nämlich als „Schicken des Schicksals ... Das Höchste über den Menschen und Göttern läßt ihr Zwischen erst aufgehen und schickt sie in dieses und schickt sie innerhalb seiner einander zu“ (99). Dieses Höchste nennt Heraklit phýsis (Nr. l08 4). Phýsis ist der waltende Aufgang, der das eine erst ins anwesende Erscheinen bringt durch das gegenteilige andere. Im diaphérein, im Auseinandertragen des Gegenwendigen kommt jedes in sein Eigenes. Wir haben eine Einheit der Gegensätze, die aber die Unterschiede bewahrt, denn ohne das diaphérein des Gegenwendigen gäbe es kein Sein, weil in dieser Weise das Gegenwendige jedes Seiende in sein je verschiedenes Wesen hinein erhält. Die phýsis ist das Sein des Seienden, sie ist das Zusammengewachsensein des Gegenteiligen und deshalb allversöhnend, vermittelnd in ihrem Offensein für das Gegenteilige. „Phýsis bedeutet das Aufgehen in das Offene, das Lichten jener Lichtung, in die herein überhaupt etwas erscheinen ... kann“ (55). Dieses Walten der Natur nennt Heraklit Verhängnis: „Verhängnis sei das Weltgesetz (lógos), das infolge des gegensetzlichen auf und ab die Dinge gestalte. Alles erfolge nach dem Verhängnis und eben dies sei ein und dasselbe wie die Notwendigkeit" (Nr. 54, 55). Ein anderer Name für dieses Geschick ist pólemos. „Kampf ist der Vater von allem, der König von allem, die einen macht er zu Göttern, die andern macht er zu Menschen“ (Nr. 29). Hölderlin sagt:
Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten
Und über die Götter des Abends und Orients ist,
Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht,
(II,122,vergl. letzte Strophe der Friedensfeier ).
Dieses einigende Eine ist Kampf 5), ist Aus-einandersetzung, weil es „alles anwesende in die wohlgeschiedenen Grenzen und Gefüge seiner Anwesung einsetzt“ (58). Je stärker aber die Entgegensetzung ist, desto inniger ist die Innigkeit des Seins. Wenn das Heilige waltet, kann der Dichter sagen: Alles ist innig (II,322).
Dieses Heilige ist Grund jeder erscheinenden Schönheit. Denn Schönheit ist dort, wo etwas ganz zu seinem eigenen Wesen, ganz in sein anwesendes Erscheinen, Aufleuchten, Glänzen gekommen ist durch den Widerstreit mit seinem gegenteilig anderem; Schönheit ist: sich im eigenen Maß halten. So ist der Mensch in seine ihm eigene Schönheit gelangt in seiner Unterscheidung zu den Unsterblichen; denn des Menschen eigentlicher Aufenthaltsbereich, seine Heimat (ethos) ist das Stehen in der Gegenwart des Göttlichen: und Einer stehet darunter / Sein Leben lang (II, 179). In diesem Wohnen erhält der Mensch sein Maß, indem er bedenkt, daß er erst dann richtig misst, wenn er Himmel und Erde in dieser Einheit des Gegenwendigen sieht. Auf und ab sind derselbe Weg (Nr. 54, Nr. 60). Wenn der Mensch zur Erde abwärts sieht, muss er zugleich zum Himmel aufwärts schauen, um die Bedingung zu sehen, dass nur durch den Himmel die Erde in ihrem Glanz erscheint. Sieht der Mensch sich nicht im Gegensatz zu den Unsterblichen, so vermisst er sich, bedenkt nicht mehr seine eigene Sterblichkeit, er wird ver-messen. „Das Lichte lässt alles hervorgehen in sein Erscheinen und Leuchten, auf dass jedes Wirkliche von ihm selbst befeuert, in seinem eigenen Umriss und Maß steht“ (58). Christus aber, der Sohn des Höchsten, ist das sinnenhaft erschienende (!) Zeichen dieses Grundes. Als Halbgott, als Mensch und Gott, zeigt er die Möglichkeit der Versöhnung von Göttern und Menschen. So ist er in seiner sinnlich-geistigen, intellektuell-historischen Einheit (IV,292) wie die Götterbilder der Antike, die Freude der Augen, das Jugendland der Augen, die Augenlust (II,188 vergl. Brief Nr. 240). In dieser gestalthaft gewordenen Erscheinung des Grundes, des Gesetzes der Versöhnung, zeigt er die versöhnte goldene Zeit am Anfang der Heilsgeschichte in ihrem höchsten Glanz, in ihrer schönsten Verklärung (Matth.17,2ff), so dass der Vater auf ihn deutet als seinen geliebten Sohn. Deshalb ist an der Gestalt ein Wunder, welches in der Madonnenhymne interpretiert wird:
Heilig sind sie,/ Die Glänzenden (II,225).
Indem Christus sich so zeigt, erstellt er die Lichtung, in der Götter und Menschen sich gegenseitig in ihre Anwesenheit bringen können. Er stiftet durch sein Erscheinen das Andenken der Versöhnung und weist so auf die Zukunft des neuen Ausgleichs zwischen Göttern und Menschen, eines Ausgleichs, der nicht geschieht „als Auslöschen der Unterschiedenen, sondern als der Götter und Menschen Rückkehr in das eigene Wesen“ (100).
Christus als Zeichen der Versöhnung setzt jedes in sein eigenes begrenztes Maß, weil nur im Durchgang durch das Eigene echte Versöhnung möglich ist. Deshalb beendet er den Göttertag, denn die Unterscheidung war nicht erhalten wegen allzu großer Innigkeit. Die Menschen sehnten sich nach dem Abgrund, Da entzog Christus sich zu rechter Zeit, denn dieses Sehnen ist wie eine Seuche, weil es das Ungleiche zwischen Göttern und Menschen aufheben möchte, verkennend das Geschick und sein eigenes Maß. Deshalb musste, zu besserer Erkenntnis dieses Geschicks, der Mensch in die Nacht der Götterferne hinaus. Durch den Tod Christi begrenzt Gott unangemessene Schritte (II,268 spätere Ergänzung: der eigentlichere Zeus). Und Dionysos darf der Bruder Christi genannt werden, weil er die Todeslust der Völker aufhält und Sorge trägt, daß die Menschen hüten das Maß (II,166 f).
Die zukommende Versöhnung ist die Einigkeit des Unterschiedenen. Diese Einigkeit ist aber nur gewährleistet, wenn jeder der Teile, die vereinigt werden, zuvor ganz in seinem Eigenen erscheint. Denn das Sein kommt nur im Durchgang durch die Unterschiedenheit zu sich selbst. Je klarer das Unterschiedene in seinem eigenen sich herausstellt, desto inniger wird die Synthese. So gewinnt das jeweils Eigene seinkonstituierende (vom Korr. mit Fragezeichen versehen) Bedeutung und wird als solches der eigentliche Inhalt des Gesangs, der die kommende Einigkeit besingt. Der späte Hölderlin wird zum Dichter des Eigenen der Sterblichen, zum Dichter der Nachtzeit, die nichts Negatives, zu Fliehendes mehr ist, sondern ihre positive Funktion im Heilsgeschehen hat. Daher kann Hölderlin sagen angesichts dieser Nachtzeit: Denn alles ist gut. Wer unter dem Gesetz des Höchsten lebt, lebt dichterisch. ,,Undichterisch“ legt Hölderlin aus als: unendlich, unfriedlich, unbündig, unbändig. Heidegger schreibt dazu: ,,Das Dichterische ist das Endliche, was sich in die Grenzen des Schicklichen fügt... Das Dichterische ist das Bündige, das Unangebundenes bindet. Das Dichterische ist das in Band und Maß gehaltene, das Maßvolle" (120). Wer unter dem Geschick steht und es erkannt hat, daß Innigkeit mit den Göttern nur durch die Begrenzung auf das Eigene sich ereignet, der nimmt sein Schicksal, d.i. seine Sterblichkeit, sein Der-Zeit-anheimgegeben-Sein auf sich und harrt unter ihm aus, er läßt sich von Zeus (Ergänzung: der eigentlichere Zeus) zurückbiegen auf seinen ihm eigentlichen Aufenthaltsbereich, läßt sich von Zeus sein Maß zuteilen. Díke ist bei den Griechen die Maßzuteilerin, ist bei Heraklit der waltende Aufgang, der das Eine erst ins anwesende Erscheinen bringt durch das gegenteilige Andere. Wenn wir den Höchsten dieser Hymne als den allgegenwärtigen Grund, als herrschenden Anfang bezeichnet haben, so ist e i n e Erscheinungsweise dieses Grundes die den Menschen das Maß zuteilende: Zeus als Gott der Zeit. Eine andere Erscheinungsweise ist die den Unsterblichen ihr Maß gebende und wird so auch Schicksal der Unsterblichen genannt, d.h. nicht, daß die Götter menschlichen Schicksalen unterworfen seien, d.h. der Zeit - sie sind Schicksallos wie der schlafende/Säugling (I,260) -, sondern daß auch sie unter dem waltenden Aufgang stehen, der ihr Geschick ist. In diesem Geschick sind sie abhängig von den Sterblichen. Denn die Götter erscheinen ja erst in der Helle des Feuers des Gegen-wendigen als Götter, d.h. aber: durch ihr Gegenteiliges, die Sterblichen, werden die Götter erst zu Göttern (Fragezeichen des Korrektors). Dieser Gedanke findet sich - zwar in der Brechung transzendentalphilosophischer Besinnung - immer wieder bei Hölderlin. Wenn der Höchste das Schicksal sowohl der Sterblichen als auch der Unsterblichen bedeutet, so liegt es nahe, ihn gar nicht mehr als den Höchsten der Götter zu sehen. Diese Schwierigkeit sieht schon Heraklit. Das einigende Eine im Gegenteiligen ist für ihn der höchste Gott (Nr. 45), der alles durch seinen Blitz (Nr. 57) in die Anwesenheit bringt, jedem sein Wesen zuteilt. In fr.52 sagt er: „Das einend Eine, das einzig Geschickliche lässt es nicht zu und lässt es zu, mit dem Namen Zeus benannt zu werden“ (Nr. 42) 6). Wenn wir im Sinne Heideggers die ontologische Differenz zwischen Seiendem (Sterblichen und Unsterblichen) und Sein erhalten wollen, so müssen wir die allgegenwärtige Natur, das Heilige, als das Unmittelbare, alles Vermittelnde in seiner Einzigkeit stehen lassen, wenn anders wir in der Identifizierung von der Höchste und das Höchste uns nicht eine „Versetzung in das Mittelbare“ (71), d. i. aber eine „Wesensvernichtung“ des Seins, zu schulden kommen lassen wollen. Die Lesart zur zwölften Strophe (H1): „es waltet über dem Fernhinzielenden mit der allversöhnenden Erde der alldurchdringende, unerschöpfliche Gott“ könnte im Sinne Heideggers interpretiert werden. Christus ist der Fernhinzielende. Er hat in seinem Verbergen die Versöhnung als fernes, zukünftig zukommendes Ziel dem Andenken übergeben. Über diesem verborgenen Weilen im Andenken eilt das Schicksal, die phýsis 7), die allversöhnende Erde 8); bis hin zur Erfüllung seiner selbst. Der Gott ist der Höchste und Herrschende, weil er wie bei Homer alldurchdringend ist, weil er allein das Schicksal kennt und in diesem Wissen Sterbliche und Unsterbliche lenkt, „des Maßes allzeit kundig“ (III,428) 9). Doch führt das zweite Attribut, das Gott beigegeben wird, das ,, unerschöpfliche“, und vor allem die Vorstellung vom Willen des Höchsten zu der Vermutung, daß eine Annäherung an den christlichen Schöpfergott vorliegt, der schöpferischer Grund
10) und wissender Wille zugleich ist. Es liegt hier bei Hölderlin eine durchgehend strenge Differenzierung nicht vor, da er die Fragestellung Heideggers in dieser Schärfe nicht sehen konnte. (Ausrufezeichen des Korrektors)
Was bei Heraklit für die Interpretation der Patmoshymne nicht gewonnen werden kann, ist der geschichtliche Raum, in dem das Ereignis der Hymne steht. Dieser ist erst bei Paulus aufgezeichnet, der ausdrücklich gegen die Gnosis betont, daß die Erneuerung (2. Kor 5,17) nicht im mystischen Prozess als Ekstase gewonnen wird, sondern Ziel der Heilsgeschichte ist. Dieser neue Aspekt bestimmt auch die theoretischen Überlegungen Hölderlins. Eine kurze Darlegung des ontologischen Untergrunds der ästhetischen Schrift „Über den Unterschied der Dichtarten“ macht dies deutlich (Neu an diesen Überlegungen ist auch die transzendentale Wendung, die das Denken des Idealismus beherrscht.).
Schon früh bedenkt Hölderlin das versöhnende Eine, das die Gegensätze in sich aufnimmt und doch erhält. So will er den Widerstreit von Subjekt und Objekt in einem Absoluten lösen (Brief l04 u. 117). In dem Aufsatz „Urteil und Sein“ heißt es: „Im Begriff der Teilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objekts und Subjekts aufeinander, und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Objekt und Subjekt die Teile sind“ (IV,226). Und er verwahrt sich dagegen, die Einheit dieses Ganzen, die er absolutes Sein nennt, der Identität gleichzusetzen (IV, 227). In „Über den Unterschied der Dichtarten“ stellt Hölderlin zunächst fest, daß eine absolute Trennung und Vereinzelung unmöglich sei, daß die Trennung als mögliche schon in dem Ursprünglich-Einigenden angelegt sein müsste, damit überhaupt geistiges Leben und seine Selbstentfaltung möglich sei und daß die Teile immer nur als Funktion des Ganzen angesehen werden könnten. Die Trennung werde notwendig, damit das Ganze zu sich selbst komme, indem es sich in den Teilen fühle, und je leidender die Trennung der Teile sei, desto mehr fühle sich das Ganze. „Die Fühlbarkeit des Ganzen schreitet also in dem Grade und Verhältnisse fort, in welchem die Trennung in den Teilen fortschreitet“ (IV,280). Was bei Hölderlin Sich-selbst-fühlen heißt (‚Bewusstsein’ nennt es der Brief 94) ist bei Heraklit das Schicken in die anwesende Erscheinung. Die Struktur des Ganzen ist aber bei beiden die gleiche (Korrektor: ‘höchstens eine ähnliche!’): das hen diapheron eauto. Ebenso ist, wie bei Heraklit, diese Trennung in dem Einen, die als ideal mögliche im Ganzen angelegt ist und als reale sich vollzieht, eine Notwendigkeit: „notwendige Willkür des Zeus“ wird „dieses Streben des Teilbaren Unendlichern nach Trennung“ (IV,280) genannt. Warum diese Trennung zugleich ein freier Akt (Willkür) des Absoluten ist, liegt vielleicht darin, daß die Struktur des menschlichen Geistes als Subjekt, das sich im Selbstbewusstsein zugleich Objekt ist, auf das Absolute übertragen wird. Das Absolute als denkendes Subjekt kommt im Gang der Geschichte zu sich selbst (Reflexionslogik als Ontologie). Damit haben wir mit unserem Problem, wie das Eine sich trennt und in der Vereinigung des Getrennten wird, was es ist, zugleich den geschichtlichen Horizont gewonnen 11). Der geschichtliche Dreischritt hat also diese Struktur: Die absolute Einigkeit in ihrer potentiellen Trennbarkeit ist „der ideale Anfang der wirklichen Trennung“ (IV,28o). Diese wirkliche Trennung erstreckt sich „bis dahin, wo die Teile in ihrer äußersten Spannung sind, wo diese sich am stärksten widerstreben“. Dann geht die „neue Einigkeit“ hervor aus „Leidenschaft und Individuen“ (IV,281) und existiert deshalb in ihren erhöhten Gegensätzen in einer bewussteren, klareren Innigkeit.
Die äußerste Spannung der Teile: dies ist die größte Ferne zwischen Göttern und Menschen, von der die zehnte Strophe spricht und von der wir sagten, daß sie notwendig sei für die kommende Einigkeit. Dass aber diese Spannung vielleicht zu groß werden kann, so dass der Bogen zu brechen droht, indem der Mensch das Ungleiche zu dulden müde geworden ist, auch dies hören wir im folgenden:
und wenn, ein Rätsel ewig füreinander,
Sie sich nicht fassen können
Einander, die zusammenlebten
Im Gedächtnis, und nicht den Sand nur oder
Die Weiden es hinwegnimmt und die Tempel
Ergreift, wenn die Ehre
Des Halbgotts und der Seinen
Verweht und selber sein Angesicht
Der Höchste wendet
Darob, daß nirgend ein
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehen ist oder
Auf grüner Erde, was ist dies?
In der Tradition des schwäbischen Pietismus war die neutestamentliche Lehre von der Endzeiterwartung sehr lebendig. Die Parusie-Reden des Neuen Testaments prophezeien kurz vor dem Erscheinen Christi (Luk. 21,31) eine „grauenhafte Verwüstung“ (Mark. 13,14): „Zuvor muß der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Heiligtum heißt, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt“ (2. Thess. 2,3ff 12). Die „Sünden der Welt“ entstehen durch „die Unverständlichkeit der Kenntnisse“ (II,171), der Kenntnisse des Geschicks, „das dir zum Heile (eiréne) dient“ (Luk. l9,42, eiréne des Neuen Testaments ist im tiefsten Sinne das Ende der Entzweiung von Gott und Mensch, Ende der Auflehnung des Menschen gegen Gott.). Die Unkenntnis des Geschicks, dessen sichtbares Zeichen Christus war, ist für den Menschen zugleich Verkennung seines eigenen Maßes. Der Widersacher, der Titan, duldet nichts Ungleiches und setzt sich absolut, er setzt sich gleich Gott, er setzt sich in den Tempel Gottes, d.h. er zerstört diesen in seinem Wesen.
Und drüber hin darf alles Freche gehn,
Und kommen muß zum heilgen Ort das Wilde (II,139f).
Der Mensch der superbia, der Ursünde, der Tantalussünde, die die Unschuld zerreißt (II,88), gleicht dem wilden Strom (vergl. II,45), der seine festen Ufer überschwemmt, die Grenzen zerstört, über alles Maß hinausströmt (den Sand ... oder / Die Weiden es hinwegnimmt - Das unbestimmte ‘es’ lässt offen, wo die Ursache für die superbia des Menschen zu finden sei.). Damit aber zerstört der titanische Mensch den Ort des feiernden Gedächtnisses, den Tempel. Alles dies aber gipfelt in der Ehrfurchtslosigkeit des Widersachers gegen die dóxa kyríu und gegen die Jünger Christi, die zum „Ruhm“ (II,188) und zur Ehre ihres „Meisters und Herrn“, ihres „Lehrers“ (II,166), zur Bewahrung der erhaltenen Lehre die erste Gedächtnisgemeinschaft gebildet hatten. Sie hatten zusammen gelebt. Nun, in der Gegenwart des Dichters, der die Zeiten in seinem Blick zusammenfasst, werden sie auseinandergerissen, denn nun ist „die Ehre der Himmlischen unsichtbar“ geworden, weil der Mensch seine Augen verschließt vor dem Glanz der Himmlischen und nicht mehr in diesem Licht seine Sterblichkeit erkennen will; weil er, ohne Demut, das „Opfer versäumt“. Christus, der den Menschen den Ausgleich von Himmel und Erde gezeigt hatte, so daß dieser offenbar wurde als die Wahrheit, stirbt alsdann. Weil die andenkenden Gemeinde mit diesem zweiten Tode Christi Anfang und Ende ihres Andenkens verliert, reißt sie auseinander; jeder lebt allein, und in dieser Einsamkeit ist seine Existenz sinnentleert, er ist heimatlos, weil er Christus, das sichtbare Zeichen der Lichtung, vergessend sich nicht mehr sieht im Lichte der Himmlischen, welches strahlt „zur Erleuchtung der Heiden“. So ist er sich und den anderen zum abgrundtiefen Rätsel geworden. Der Mensch verkennt sein eigenes Wesen.
... nirgend ein
Unsterbliches mehr am Himmel zu sehn ist oder
Auf grüner Erde,
Himmel und Erde sind der Aufenthaltsbereich von Göttern und Menschen. Das ethos des Menschen ist sein Stehen in der Gegenwart des Göttlichen. Der Mensch braucht die Anwesenheit der Unsterblichen auf der Erde, um an ihnen sein Maß zu treffen; die Erde ist auf die Gegenwart der Himmlischen angewiesen. Der Mensch, der sich vermisst, vertreibt die Unsterblichen von der Erde. Aber auch die Himmlischen brauchen den Menschen, in dessen Sterblichkeit sie ihre eigene Unsterblichkeit erkennen können. Wenn nun der Mensch so sein will wie die Götter, nimmt er ihnen ihren Aufenthaltsbereich; am Himmel ist nichts Unsterbliches mehr zu sehen. Dass objektiv der Mensch Mensch bleibt und der Gott Gott, steht nicht zur Frage. 13) Die Frage ist nur, ob der Mensch seine Aufgabe, die ihm vom Gesetz der Versöhnung zugewiesen ist, erfüllt oder verfehlt, ob er sich für die Gnade offen hält oder ob er sich ihr verschließt. Hier, in unserer Strophe, hat der Mensch in seiner Hybris sich der Gnade entgegengestellt, er hat die Unsterblichen im Himmel und auf grüner Erde „unerkenntlich“ werden lassen. Unerkenntlich ist aber aus diesem Grunde das Gesetz der Versöhnung geworden: der Höchste wendet sein Angesicht 14). Durch seinen Blick erstellte er die Lichtung, in der sich Götter und Menschen gegenseitig in ihr eigenes Wesen erleuchten konnten. Der Blick ist abgewendet, die Bedingung der Möglichkeit der Versöhnung entfällt, der Grund der Vermittlung ist Abgrund geworden. Die Menschen haben die Verbindung mit ihrem allversöhnenden Grund verloren, sie haben kein Bleiben mehr im Leben; die Folge aber ist grauenhafte Verwüstung. Himmlische und Sterbliche sind „unversöhnt“, und „das freundliche Licht gehet hinunter und die Nacht kommt“ (II,155). In ,Germanien’ sagt Hölderlin (II,157):
Denn wenn es aus ist, und der Tag erloschen,
Wohl triffts den Priester erst, doch liebend folgt
Der Tempel und das Bild ihm auch und seine Sitte
Zum dunkeln Land und keines mag noch scheinen.
Ist die Finsternis, die die Erde bedeckt und die Dunkelheit, in der die Völker leben, endgültig? Ist das Gedächtnis an die Gestalt Christi und damit an das Gesetz der Versöhnung vollständig erloschen? Wenn nicht, was bedeutet diese Zeit der größten Götterferne? Hin zu dieser Frage treibt in dreimaligem höher und höher gesteigertem Ansetzen die zehnte Strophe. In ihrem , „Wenn“ gestaltet sie die Zeit aus dem Grunde ihres Wesens heraus. Mit der lapidaren Frage: was ist dies? gipfelt sie in einer ungeheuren Spannung, die in der nächsten Strophe - nach einem kurzen Verhalten schrecklicher Ungewissheit in der Pause zwischen den beiden Strophen - in dem ruhig, breit und feierlich dahinfließenden Strom des biblischen Vergleiches sich löst:
Es ist der Wurf des Säemanns, wenn er faßt
Mit der Schaufel den Weizen,
Und wirft, dem Klaren zu, ihn schwingend über die Tenne.
Ihm fällt die Schale vor den Füßen, aber
Ans Ende kommet das Korn,
Die Lösung durfte nicht ausbleiben bei einem Dichter, der schreiben kann: „Denn alles ist gut“ (omne ens est bonum, „Nichts ists, das Böse“ II, 222 ). Für ihn muss in der grauenvollen Zerstörung ein Sinn liegen. Hegel schreibt: „Der einzige Gedanke, den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei" 15) (Erbe eines säkularisierten Gottvertrauens, aufklärerischer Optimismus 16)). Der Wurf des Säemanns, das ist die Zeit der gegenwärtigen (Präsens der l0. Str.) totalen Verwirrung, der äußerste Punkt der exzentrischen Bahn, die mit dem Urchristentum begann. Der Werfende aber ist der Vernünftige. „Es ist der Wurf das eines Sinns“, der Vernunft in der Geschichte, die hier ihre List gebraucht. Der Weizen, das sind die Menschen, die in die Klarheit ihres Geschicks geworfen werden, dorthin, wo Götter und Menschen versöhnt sind in einer echten, klaren Synthese, weil „das Schicksal seinen Ausgleich gefunden hat, wenn das Ungleiche als das Ungleiche anwest“ (99). In der Zeit der Götterferne scheiden sich die Geister, die Bösen trennen sich von den Guten wie die Spreu vom Weizen: die Zeit der größten Verwirrungen ist eine Enthüllung des Titanischen im Menschen; der Wurf ist das Gericht über die Titanen: „Die Wurfschaufel hat er in der Hand und wird seine Tenne reinigen, den Weizen wird er in seine Scheune sammeln, die Spreu aber in unauslöschlichem Feuer verbrennen“ (Lk 3,17). „Der Mensch der Sünde muss geoffenbart werden“ (2 Thess 2,). Er wird offenbar, indem er als Schale vor die Füße des Worflers fällt, „ein furchtbar Ding, Staub fällt“. Demütige werden von den Übermütigen getrennt; mit jenen bestellt der Säemann ein neues Feld: das Reich Gottes; über diese „entsteht Gottes Gericht“, weil sie nicht „Gott treu und mit Unterscheidung bewahrten“ (II, 261). „Ans Ende kommet das Korn“. Das Werk des Schicksals geht eilend seinem Ziele, seinem Ende zu: die Synthesis, Versöhnung von Göttern und Menschen. Dann sind die Menschen (Korn) ganz in ihrem télos (Entelechie), in ihrem eigensten Wesen, weil sie, alles Titanische abgelegt habend, den Himmel in seinem Wesen anerkannt und deshalb erkannt haben, so dass der Himmel sich wieder zur Erde neigen kann: eine geläuterte Menschheit, eine gereinigte Geschichte kann zur Synthese kommen mit der Ewigkeit, und keine wilde Vermischung wird die Einheit trennen können: das Reich Gottes ist da. „Sehet darin einen Erweis des gerechten Gottes, daß ihr würdig erachtet werdet des Reiches Gottes, für welches ihr ja leidet“ (II. Thess 1,5f).
Und nicht ein Übel ists, wenn einiges
Verloren gehet und von der Rede
Verhallet der lebendige Laut,
Denn göttliches Werk auch gleichet dem unsern,
Nicht alles will der Höchste zumal.
Ein furchtbar Ding ist das krínein des Wilden, Frechen vom Unschuldigen. „Nicht gar ein Übel ists, wenn einiges/ Verloren gehet manchmal, von Reden / Verhallet der lebendige Laut. (II,186) Was hier verloren gehet, ist nicht die Spreu (dieses Verlieren ist ein furchtbar Ding), verloren gehet der lebendige Laut, das Wort, das vom Prinzip alles Lebens spricht, vom lógos, vom Weltgesetz der Versöhnung. Es ist das Wort des von Christus gestifteten Andenkens an diese Versöhnung. Nicht also ist das Gedächtnis ganz zerstört, wie die l0. Strophe vermuten ließ. Wäre das Gedächtnis ausgelöscht, ständen wir vor dem Problem, wie kann jemand sich wieder des Vergessenen erinnern, ein Problem, das Augustinus im l0. Buch der Confessiones vergeblich zu lösen sucht. Zwar geht einiges verloren, manchmal, denn das Wort des Dichters, welches das Gedächtnis feiert, ist ein verhallendes, ein „sterblich Lied“ (II,28). Doch anderes bleibet: „Es bleibet aber eine Spur/Doch eines Wortes“ (II,171). In ,Germanien’ sagt Hölderlin (II,157):
Nur als von Grabesflammen, ziehet dann
Ein goldner Rauch, die Sage, drob hinüber,
Und dämmert jetzt uns Zweifelnden um das Haupt,
Zwar lässt die Wildnis der Nachtzeit die Herrlichkeit der Versöhnung immer mehr in Vergessenheit geraten, doch hat auch dieses Verhallen sein Gutes und ist nicht ein Übel. Denn wie sollten die Menschen stark genug sein, den Blitz Christus zu ertragen, wo nicht einmal die Jünger vermochten, ihre „Sehnsucht ins Ungebundene“ (II, 206) zu überwinden. Die Menschen sind noch nicht stark genug, den Göttern zu begegnen, ohne die Bindung an ihr Eigenes aufzugeben; sie sind nicht einmal stark genug, dem vermittelnden Wort des Dichters, welches kündet von der Helle der Versöhnung - selbst ein scharfer Strahl - auszuhalten. „Nicht wollen sie, wenn ich es ihnen sage, sie (mir) blühen. Es träfe zu scharf“ (13. Str. Lesart H2). Und so muss einiges vom Wort des Dichters verloren gehen, das Wort muss an Schärfe verlieren. Den Menschen aber ist das Dunkel 17) zur Heimat angewiesen, damit sie das Eigene erlernen.
Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß
Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten
Freuden, (II,98)
Deswegen ist nächtliche Zeit der Götterferne:
Daß milder auf die folgende Zeit
Der hohe Strahl
Durch heilige Wildnis scheine. (II, 135f.)
Auch wär uns, sparte der Gebende nicht
Schon längst vom Segen des Herds
Uns Gipfel und Boden entzündet. (III,429)
Der Wille des Höchsten ist, daß sein Weltgesetz befolgt werde: dass die Einheit in allzugroßer Innigkeit sich auseinandertrage in ihre Gegensätze und dass die „neue Einigkeit“ hervorgehe aus „Leidenschaft und Individuen“, in diesem Durchgang erst eigentlich wird, was sie ist. Würde die Stufe des Durchgangs zur Synthese übergangen, würden Anfang und Ende zusammenfallen, ohne dass der geschichtliche Gang den Übergang bildete, wäre dies ein treuloses Verkennen des göttlichen Werkes 18), das in der Sukzession des Dreischrittes sich verwirklicht, nicht aber im „Zumal“. Das Werk des Höchsten, das Schicksal, umfasst in dieser Sukzession Nacht und Tag, Irren und Frieden, Tod und Leben: „So schreitet fort der Götter Schicksal wundervoll und voll des Todes und Lebens“ (Lesart H1 zur 12. Strophe). So gewinnt der Verlust in götterferner Zeit seine positive Bedeutung; er ist ein Sparen der Götter, weil die Menschen noch nicht stark genug sind zur Verkündigung der zukommenden Versöhnung, weil sie erst im Durchgang durch die Zeit, im treuen Ergreifen des Eigenen, reif werden zur Versöhnung.
Denn göttliches Werk auch gleichet dem unsern,
Des Menschen Leben und Wirklichkeit ist ein Abbild der göttlichen Wirklichkeit. „Was ist der Menschen Leben? ein Bild der Gottheit" (II,218) . Jeder einzelne Mensch durchgeht den Zyklus vom Zentrum der höchsten Einfalt über die exzentrische Bahn der Zeit hin zum ziellosen Irren der Zeitlosigkeit, zum eisernen Schlaf und Tod, und zurück zum bewußten Ergreifen des Zentrums, zur höchsten Bildung. Auf der exzentrischen Bahn aber geht einiges verloren, die Unschuld des Anfangs, und dies muß so sein, denn nur im Umkreisen der Bahn kann das Ganze (= Unendlichkeit....) gewonnen werden, nur der Tod ist das Tor zum Leben, und das „Leben nährt sich vom Leide“ (Empedokles). Diese Bahn der Heilsgeschichte, die kleine des Menschen und die große der Weltgeschichte ist geleitet von dem wissenden Willen des Gottes, der das Maß kennt. Nur der himmlische Vater weiß die Zeit des Endes, der Reife, der Ernte.
Ein Gott weiß aber,
Wenn kommet, was ich wünsche, das Beste. (II, 164)
Wenn aber der Mensch die Bahn abkürzen und frühzeitig das Ende erzwingen wollte, unausharrend sein Schicksal abwerfend, Gottes Zorngericht wird über ihn kommen. Von der Gefahr dieser Treulosigkeit spricht die 12. Strophe. Bisher war die Hybris gezeigt, die, menschlicher Bedürftigkeit überdrüssig, sich Gott gleich zu setzen versuchte und so das Andenken Christi verwehte. Dies war Schwärmerei. Nun tritt die Hybris ans Licht; die aus „Unruh und Mangel“ (Lesart zur Dichterhymne H IV, 365) Gottes Erscheinen verfälscht: das falsche Priestertum, das sein Amt in ungebührender Weise gebraucht. Der wahre Priester ist der Dichter, der sich an sein Eigenes gebunden hat.
Christus hatte das Zwischen sichtbar gemacht, in das hinein Götter und Menschen zugeschickt sind, so daß sie sich - im Lichte dieses Zwischen sich gegenseitig in ihr Wesen setzend - begegnen, ausgleichen, versöhnen können.
„Gott hat sich mit der Welt in Christus versöhnt (II Kor 5,19)
Das Amt des Dichters ist, dieses Zwischen im Bewußtsein erhalten, indem er das Gedächtnis Christi im Bewußtsein hält, oder es neu zu erinnern, wenn die Götter zu den Menschen herabgestiegen sind, die Menschen aber die Götter nicht in ihrem Eigenen erkennen, weil sie nicht in der Lichtung stehen. Der Dichter hält den Raum offen für die Begegnung von Göttern und Menschen. Sein Amt ist das des Mittlers, das Amt der Versöhnung ( diakonía tes katallages II Kor 5,18). Doch er verkündet die Versöhnung nicht aus eigenem Ermessen, sondern immer gemessen an der Gestalt Christi. Nicht schafft er aus eigener Kraft ein Bild der Versöhnung - in der Liebe zwischen Diotima und Hyperion hatte der Dichter, sich vermessend, ein solches Bild gebildet -, sondern er kündet die zweite Versöhnung von Göttern und Menschen im Andenken an die lebendigen Bilder einer gewesenen Versöhnung. Nicht durch sich selbst spricht der Dichter den lógos tes katallages, sondern durch Christus und „an Christi Statt“ (II Kor 5,20). Nicht darf er selbst den Blitz, das Symbol der Versöhnung schaffen, wie er es einmal in Diotima getan hatte, ihm ist aufgegeben, des Vaters Strahl ,,dem Volk ins Lied / Gehüllt ... zu reichen" (II 124). Christus aber offenbart sich in der Nachtzeit in seinem Verbergen. Würde man dieses Wesen Christi verkennen und in die sichtbare, feste, errechenbare Offenheit stellen (ein falsches, neuzeitliches Wahrheitsideal) 19), hieße das, ein Bild Christi bilden, ihn, der erst in seinem Verbergen anwest, festlegen, fixieren, verrechnen wollen auf sein Wesen hin, um sich so in einem schlechten Nennen dieses Wesens zu bemächtigen. Damit aber wäre das Offene der Versöhnung verstellt. Es wäre eine Versöhnung verkündet, die nicht von Gott ist, sondern von einem Menschen, dem falschen Priester, der sich Gott gleich setzte, in dem Glauben, die Versöhnung erzwingen, selbst schaffen zu können. Dieser Versuch einer imitatio Dei aber ist titanisch, die Götter sind die „Unnachahmungslosen“. Das Ergebnis dieses Versuches ist ein Bild, das immer nur Menschenbild bleibt, immer nur dem Göttlichen ähnlich (similis) bleibt, immer nur Abbild eines Urbildes: ein Mensch, der, wenn er auch vergöttlicht wird, aus seiner Ebenbildlichkeit mit Gott heraus zum Übermenschen proklamiert wird, doch immer nur Mensch bleibt.
Doch es zwinget
Nimmer die weite Gewalt den Himmel. (II, 49)
Ein Bild von Gott nachahmen, indem der vermessene Dichter Christi Verkündigung auf die eigene Gegenwart hin verrechnet, indem der falsche Priester die Verkündigung Christi so interpretiert, wie es ihm geeignet erscheint, d.h. aber, seine eigene Lehre verkündet im Namen Christi - die Sünde der Orthodoxie, die sich „das Göttliche dienstbar gemacht hat“ (II, 48) -, ist das Vermessen des Menschen, der Gott nicht in seinem Anderssein stehen lassen will, der nicht auf das Geschick, das Götter und Menschen trennt, hören will.
Wer Gott auf seinen eigenen Horizont verrechnet, ist in seiner Hybris der zukommenden Versöhnung entgegen und muß als Staub zur Erde fallen.
Vor allem aber der Dichter lebt in der Gefahr, sich Gott gleichzusetzen, indem er Gottes Wesen auf sich hin verrechnet. Denn er hat in der schöpferischen Kraft des Wortes den Reichtum, aus dem Grunde heraus ein Zeichen zu errichten, das als Zeichen der versöhnten Zeit gelten könnte:
Zwar Eisen träget der Schacht,
Und glühende Harze der Aetna.,
So hätt ich Reichtum,
Ein Bild 20) zu bilden, und ähnlich
Zu schaun, wie er gewesen, den Christ,
Wenn aber einer spornte sich selbst,
Und traurig redend, unterweges, da ich wehrlos wäre,
Mich überfiele, daß ich staunt und von dem Gotte
Das Bild nachahmen möcht ein Knecht -
"Zwar" hat der Dichter Reichtum, um, wie die phýsis selber, aus dem Grunde heraus eine zeichenhafte, verbindliche (feste) Wirklichkeit zu schaffen, "aber" er weiß, wenn er sich durch diesen Reichtum verleiten läßt, eine verbindliche, d. i. wesensverstellende Gottesvorstellung zu stiften, wird der Zorn Gottes über ihn kommen. Deshalb ist er "unterweges", er verstellt sich nicht das zukünftig Zukommende durch Verrechnung auf seine Gegenwart, sondern bleibt offen dem Zukommenden in der Erinnerung an das Ge-wesene. Doch "lang ist die Zeit" (II 202) der Götterferne, die Erinnerung verhallt immer mehr, der Dichter, der sich verlassen sieht, wird "traurig" und beginnt zu "träumen" (H2) von dem Ereignis des Wahren. Nun, da er die Traurigkeit kennt, auch von dem Reichtum seiner Schöpferkraft weiß und "staunt" über die mögliche Verwendung dieses Reichtums, ist er "wehrlos" dem Überfall des Versuchers gegenüber. Dieser Versucher spricht ihn an, "traurig," wie die Emmausjünger, denn auch er sucht einen Halt in dem Irrgarten der Nachtzeit und spornt sich deshalb an, das Kommen des Wahren zu erzwingen, selbst ein Zeichen der Versöhnung zu errichten, ein Bild Christi und damit den Grund eines neuen Zwischen von Göttern und Menschen. So verrechnet er das Wahre auf seine Gegenwart, auf sein Hier und Jetzt denn "ihm ist Gegenwärtiges lieb" (II 147), und er wünscht auszuruhen in einer Wahrheit, die ihm verfügbar geworden ist. Um diese Wahrheit zu erstellen, greift er nach dem Reichtum des Dichters. In dem Augenblick aber, wo er stolz über die Wahrheit zu verfügen glaubt als ihr Herr, ein "Ritter mit Sporen" (II 60) , wird er ein Knecht seiner selbst. Denn immer bleibt er Mensch. Das Kennzeichen seiner Menschlichkeit aber ist seine Bedürftigkeit (indigentia). Der Mensch bedarf zur Erhaltung seines Seins (esse conservare, sotería tu einai) des anderen, des Objekts; zur Vollendung seines Seins bedarf er des Göttlichen. Also ist der Mensch nur frei, wenn er seinen Aufenthaltsbereich in der Gegenwart des Göttlichen hat. Am deutlichsten wird dieser Verlust der Freiheit im Verkennen des Eigenen am Beispiel des Todes. Will der Mensch sein wie Gott und sich. nicht sehn im Lichte der Götter, wo er sich erkennen könnte als der Sterbliche, ist er nicht mehr offen für seinen Tod. Tod ist ihm dann das Grauenerregende, das sein höchstes Ziel, die Gleichheit mit den Göttern, umkehrt in das Gegenteil: er wird ein Knecht des Todes. Hätte er seine Sterblichkeit im Lichte der Götter erkannt und als sein Eigenes auf sich genommen, wäre er frei zum Tode geworden 21). Gott aber, der Höchste, der Grund alles Seienden, ist durch sich selbst und nicht bedürftig eines anderen, er ist "absolutes, in sich selbst gegründetes Sein" (Schiller), der "Freieste" (Lesart von H2). (Daß nur der Höchste oder auch sein sichtbares Zeichen, Christus, als der Freieste bezeichnet wird, bestätigt die Berechtigung der Heideggerschen Trennung, die Götter und Menschen dem Seienden, den Höchsten aber dem Sein zuordnet. Auf diese Trennung verweist auch die Änderung des nächsten Verses. Die Götter werden zu "des Himmels Herrn". Diese Änderung ist aber nicht vollständig durchgeführt, so daß das "sie" des 7. Verses der Strophe nur vom Vorentwurf her zu verstehen ist.
Im Zorne sichtbar sah ich einmal
Des Himmels Herrn, nicht, daß ich sein sollt etwas, sondern
Zu lernen.
In H1 lesen wir: "Dann kommen im Zorne sichtbar die Götter." Im Anklang an Joh. Off. 19,11, Apg. 6,56 wendet der Dichter diesen Vers ins Persönliche, so daß wir das "einmal" auch aus der Biographie Hölderlins verstehen dürfen. Wir denken an den 'Hyperion', in dem die freche Vermischung von Göttern und Menschen so offensichtlich ist, daß der Roman den orthodoxen Zeitgenossen ein Skandal sein mußte (III 12). Die Götter sind von den Menschen gesetzt 22), der Mensch (Diotima) ist zum Gott erhoben. Das Lebensprinzip alles Seienden als das Gesetz des Gegenwendigen, das in Christus Gestalt wurde, wird nicht beachtet, und der Höchste als der wissende und herrschende Wille "ergrimmt"(II 186) darüber, daß der Mensch sein Gesetz nicht achtet und sich vermißt. 23) "Wer aber ungehorsam gegen den Sohn ist, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm" (Joh. 3,36). Von Johannes, der dies schreibt, sagt Hölderlin: "Rein aber bestand/ Auf ungebundnem Boden Johannes." (II 189). Ungebunden heißt absolut. (Korrektor schreibt „gut!“) Im Angesichte des Absoluten bleibt Johannes rein, bleibt gebunden, 'dichterisch', und erkennt das je Eigene von Gott und Mensch: "Der von oben kommt, steht über allem" (Joh 3,31). Ebenso Hölderlin: Er zwingt seinen Stolz nieder, verbietet sich falsches Wünschen, hemmt in einem plötzlichen Abbrechen (Anakoluth) den Strom des Titanischen, der alles hinwegschwemmen möchte, und kann nun, unschuldig und rein geworden, sagen: "Die/Sphäre,/ die höher/ ist, als/die des Menschen,/ diese ist der Gott". 24)
Auch Hölderlin lebt nun "dichterisch", er hat "den freien Gebrauch des Eigenen" (13o) erlernt. So dichtet er den 'Empedokles' (die Harze des Aetna verweisen auf diese Gestalt), der seine Hybris büßt. Dichterisch leben heißt lernen, immer unterweges sein, immer offen sein für das Zukommende in der Erinnerung an das Gewesene. Lernen ist auch ihm anámnesis. Er hört auf das von Christus verkündete Gesetz des Ausgleichs. Er weiß: er "ist" nur im Lichte der Unsterblichen, nie aber "ist" er etwas für sich, absolut. Lernend wacht der Dichter geduldig in der Nacht. Demütig nimmt er das Schicksal seiner Zeitlichkeit auf sich. Nicht will er den Göttertag in frühzeitigem Wachstum erzwingen,
Denn es hasset 25)
Der sinnende Gott
Unzeitiges Wachstum. (II 234)
Gütig sind sie, ihr Verhaßtestes aber ist,
Solange sie herrschen, das Falsche,
Die Güte Gottes ist Wahrheit und Schönheit: das Gesetz der Versöhnung, das nur im gemeinsamen Andenken an seine Offenbarung durch den Gewesenen erkannt wird. "Voll Güt ist. Keiner aber fasset/ Allein Gott" (II 181). Dieses Gesetz ist die Schickung des lebendigen Einen, welches nur 'ist' durch die Unterscheidung seiner Teile hindurch. Ist das Gesetz erfüllt, hat sich das Wahre ereignet: das "Einssein im Getrenntsein". Dies ist des jungen Hegel (Fragment der theol. Jugendschriften) Formel für das Wesen der Liebe. Hegel 'denkt' wie Hölderlin. Liebe, Güte, Schönheit, Wahrheit, Leben, Frieden, das Heilige, das Ganze sind für Hölderlin Synonyma. Das Falsche ist die Verleugnung des Wahren.
Im Falschen befangen, bindet der Mensch sich nicht an sein Eigenes 26): "Ungebundenes aber/ Hasset Gott" (II 167). Als Gott der Zeit schickt er alles in sein Maß. Das ist die Herrschaft des Zeus. Im Frieden, wo jedes von selbst ( sponte sua) sein Maß ergreift, ist sie nirgend zu sehen (III 428).Der titanische Mensch aber widersetzt sich der Herrschaft des Zeus
und es gilt
Dann Menschliches unter Menschen nicht mehr.
Im 'Hyperion' lesen wir: "Doch können wir auch des Triebes, beschränkt zu werden, zu empfangen, nicht stolz uns überheben. Denn es wäre nicht menschlich und wir töteten uns selbst" (III, 213. Das Andenken an das Heilige, an das unterschiedene Beieinander von Göttern und Menschen, ist erloschen. "Elevtherä, der Mnemosyne Stadt" sind „die Locken gelöst“ (II 207). Der Mensch lebt außerhalb der Lichtung und erkennt sein Eigenes nicht mehr im Lichte der Götter. Denn "das Andenken ist ein Festmachen, das an ein Festes hindenkt, woran die Denkenden sich halten, um sich in ihrem eigenen Wesen festhalten zu können" (135 ). Der Mensch, im Falschen befangen, versteht sich nicht mehr als Mensch. Er glaubt sich als Gott und findet sich als Wurm. "Er fragte mich, wie ich die Menschen auf meiner Reise gefunden hätte? Mehr tierisch als göttlich, antwortete ich ihm. Das kömmt daher, daß so wenige menschlich sind" (III 198). "Unverständlich und gesetzlos ist vor Augen der Sterblichen ihr eigenes Leben" (H1): Ohne Bezug zum bleibenden Grund findet sich der Mensch ausgeliefert der zeitlichen Sukzession. Gebunden an den 'Pflock des Augenblicks' sucht er Halt an den äußeren, wechselnden Erscheinungen (dóxa). So ist er ganz dem 'Wechsel der Erscheinungen ausgeliefert. Er findet sich haltlos, lebt ständig in Angst und Sorge. Er, der sich über den Tod erheben wollte, stirbt in jedem Augenblick ("wir töteten uns selbst"). Auf zwei Weisen sucht er dieser Haltlosigkeit zu entkommen. Entweder sichert er sich durch starre Regeln und tote Satzungen oder er zieht sich ganz auf sich selbst zurück und macht sein Ich zum Maß aller Dinge. Er sieht sich als letztes Absolutes und glaubt sich berechtigt, alle gemeinschaftsbildenden Gesetze zu übergehen. Unangebunden, willkürlich, herrscht er über die Menschen (Raskolnikow mordet, um sich zu beweisen, daß er Gott ist.
27)). So bereitet sich der Mensch durch seine Unmenschlichkeit selbst das "Zorngericht" (Luk. 21,23) Gottes:
jedoch ihr Gericht
Ist, daß sein eigenes Haus
Zerbreche der und das Liebste
Wie den Feind schelt und sich Vater und Kind
Begrabe unter den Trümmern,
Wenn einer, wie sie, sein will und nicht
Ungleiches dulden, der Schwärmer. (II 152f vergl. Mark. 13,12)
Denn sie nicht walten, es waltet aber
Unsterblicher Schicksal und es wandelt ihr Werk
Von selbst, und eilend geht es zu Ende.
Dieser Satz wurde der Ausgangspunkt unserer Interpretation dieser Hymne. Leicht wäre er zu deuten gewesen, wenn wir in dem "sie" die Menschen gesehen und unter "Unsterblicher Schicksal" die Herrschaft des Zeus verstanden hätten. Sie geht zu Ende, weil der Friede kommt. Doch die Deutung des "sie" als Menschen ist gezwungen; gemeint sind die gütigen Götter, die nicht walten, weil über ihnen ihr Schicksal waltet, so daß ihr Werk "von selbst` wandelt.
Die säuberliche Trennung von: der Höchste (= Schicksal), Götter und Menschen und Christus, die wir aus methodischen Gründen vornahmen, ist bei Hölderlin nicht durchgehend. Gerade an dieser Stelle wird ein Schwanken spürbar. „Gütig sind sie“ hatten wir gedeutet als das Heilige, die Güte des Geschicks. "Sie" faßten wir in Parallele zu der .Änderung von "Götter" in "des Himmels Herrn'' als Pronomen für den Höchsten auf. Den Plural in "Denn sie nicht walten" aber müssen wir im Rahmen unserer Interpretation genau nehmen: Über den Göttern waltet das Geschick, das, wenn es im Ziel ist, Götter und Menschen in ihre volle Wirklichkeit gestellt und so in die Versöhnung geschickt hat. Das Erreichen dieser Wirklichkeit (Werk) ist das Gesetz des Geschicks, und so wandelt das Werk von selbst. Von hier aus können wir das "sie" in "Gütig sind sie" auch buchstäblich verstehen: die Götter wissen um das Gesetz als das Gute, Heilige und herrschen danach als die Gütigen und hassen jede Mißachtung des Geschicks. Es gehört zu der téchne Hölderlins 28), daß er die verschiedenen Töne miteinander verzahnt, indem er den einen Ton Über die Strophe hinausführt oder den nächsten schon am Ende der Strophe beginnen läßt. So beginnt der Abgesang der Hymne am Ende der 12. Strophe:
Wenn nämlich höher gehet himmlischer
Triumphgang, wird genennet, der Sonne gleich,
Von Starken der frohlockende Sohn des Höchsten,
Ein Losungszeichen, und hier ist der Stab
Des Gesanges, niederwinkend,
Denn nichts ist gemein. Die Toten wecket
Er auf, die noch gefangen nicht
Von Rohen sind.
Das Jahrhundert zu reinigen, die Menschen zu erziehen, um die Theokratie des Schönen zu stiften ist Vermessenheit, weil Alabanda29) und Hyperion nicht warten wollen, bis die Zeit reif ist. Das Kommen der Versöhnung ist der Gnade des Geschicks überlassen. Nun aber sind die Tage der Gnade gekommen. Die Zeit hat sich zu ihrem Abend hin geneigt, der Morgen des neuen Göttertages bricht an: der Sonnengott geht auf in himmlischem Triumph. Kehren die Götter zur Erde wieder, ist das Gesetz der Versöhnung erfüllt. Diese Erfüllung zeigt Christus, das Zeichen des Vaters. So geht, er den Göttern voran als die Sonne und zeigt sichtbar die Helle der Lichtung einer neuen Begegnung von Gott und Mensch, frohlockend 30), daß das verborgen Zukünftige wie einst wieder ins Licht gegenwärtiger Erscheinung tritt, nicht erzwungen, sondern durch Gnade. Das Singen des Göttertages ist der Höhepunkt der Hymne. Doch er wird zurückgenommen, indem Hölderlin zugleich mit dem Feiern des Triumphgangs dem Dichter seine Aufgabe hierbei zuweist. Christus erscheint als Zeichen des Zwischen, der Dichter kündet dieses Zwischen in zweifacher Weise: die Gnade vorbereitend und die Fülle der Gnade feiernd. Nur wenn der Mensch mit der Gnade mitwirkt, kann die Gnade sich ereignen. Der Dichter wirkt mit der Gnade mit, indem er der Starke ist.
Nicht darf er, wie die Jünger es waren, gefährdet sein, im Angesicht des Blitzes, sein Eigenes vergessend, sich in das himmlische Feuer zu stürzen. Mit der Gnade mitwirken, stark sein, heißt: sein Maß erkennen, weil nur so der Ort erstellt ist für die Begegnung. Der Dichter muß die Götter in ihrem Wesen anerkennen und erkennen, beim rechten Namen nennen.
Nur so kann die Gnade des Geschicks wirksam werden. "Das Schicksal schreitet fort", und wenn "in ihren Taten erkannt wieder die Himmlischen beim rechten Namen genannt sind, siehe! dann ist die Zeit des Gesangs". Dies entnehmen wir der Lesart H1: Nur indem der Mensch als der Starke die Götter in ihrem Wesen anerkennt, ist Begegnung möglich. Das Titanische des Menschen, das der Gnade entgegenwirkt, muß als Staub zur Erde fallen, damit der Raum des Zwischen offen werde, damit Christus im Nennen erkannt werde (Widmungsfassung) und so als Losungszeichen 31) gelte für das kommende Reich Gottes. Deswegen müssen auch die Toten 32) erweckt werden, die titanischen Menschen, die sich in ihrer Unmenschlichkeit selbst getötet hatten. Sie müssen nun zu ihrem eigenen Wesen zurückgerufen werden. Dies aber vermag der Gesang, der Zauberstab der Muse (I 139), weil er Kunde gibt von der Lichtung, in der das je Eigene sich im Lichte des gegenteilig anderen sieht. Wo aber diese titanischen Menschen im äußersten Punkt der exzentrischen Bahn, in der "exzentrischen Sphäre der Toten" (V,215), aus dieser Bahn hinausgeschleudert werden, da vermag auch der Gesang nichts, da ist der Mensch vom Rohen gefangen 33). Die Starken 'nennen' als Starke den Sohn des Höchsten; dies heißt: mit der Gnade mitwirken, die Himmlischen 'niederwinken', zum Feste einladen, das Fest vorbereiten. Wenn der Dichter diese Aufgabe erfüllt, "dann ist, wie jetzt, die Zeit des Gesanges" (H2) - in der Widmungsfassung sagt Hölderlin: " h i e r ist der Stab/ Des Gesanges" -, weil nun der Raum offen ist für das Ereignis der Versöhnung. Daß diese Versöhnung nicht ausbleibt, daß das Geschick sich gnädig erfüllt, dies weiß der Dichter, "Denn nichts ist gemein'', alles hat seinen guten "Sinn", weil der zuschickende Grund die waltende Vernunft des Absoluten ist. Jetzt, wo das Wesen Christi anerkannt ist, so daß nichts Titanisches mehr das Aufgehen des Göttertages hindert, kann der Dichter den Frieden 'feiern', kann er seine eigentlichste Aufgabe erfüllen, wird er erst eigentlich zum Dichter. "Der Tag des Brautfestes ... bestimmt den Geburtstag des Dichters, d. h. das Tagen, in dessen Licht das Offene sich lichtet, so daß der Dichter das kommen sieht, was sein Wort sagen muß: das Heilige:
Jetzt aber tagts! ...
das Heilige sei mein Wort. (98)
Der Gesang ist die Frucht der dichterischen, demütigen Stärke und der Gnade der sich offenbarenden Götter.
Der Dichter feiert, d.h. er vollzieht die Feier des Triumphgangs in seinem Dichten - und feiert doch auch nicht.
Schon in den bisher interpretierten acht Versen, die die Wirklichkeit der Feier stiften, nimmt er dieses Feiern zurück in die gleichzeitige Besinnung auf die Aufgabe des Dichters, weil der Dichter nur aus der Distanz des Noch-nicht-erreicht-habens das zu Erreichende hymnisch feiern kann. Vollends tritt nun im folgenden dieser Vollzug des Feierns zurück:
Es warten aber
Der scheuen Augen viele,
Zu schauen das Licht. Nicht wollen
Am scharfen Strahle sie blühn,
Wiewohl den Mut der goldene Zaum hält.
Wenn aber, als
Von schwellenden Augenbraunen,
Der Welt vergessen
Stilleuchtende Kraft aus heiliger Schrift fällt, mögen,
Der Gnade sich freuend, sie
Am stillen Blicke sich Üben.
Die Menschen, die sich in ihrer superbia selbst in die Finsternis gestürzt hatten, sind deshalb "unwissend" (H2), doch haben sie eine Ahnung von der Herrlichkeit bewahrt, sind voller Sehnsucht und warten scheu auf die Erfüllung ihrer Sehnsucht, auf das helle Licht der zukommenden Versöhnung. Diese ist nah doch schwer zu fassen. So scheuen die Unwissenden die kommende Herrlichkeit, mit Recht, denn der Strahl des Wissens würde sie, weil sie zu schwach sind, töten. Der Dichter weiß dies. Deshalb muß er mit einem „aber“ sein gegenwärtiges Feiern zurücknehmen, um die Menschen zu schonen. Denn das den erscheinenden und in Erscheinung bringenden Strahl feiernde Wort ist, weil es die Feier vollzieht, das Wesen des Strahls unmittelbar fasst, selbst ein scharfer Strahl, der die Menschen nicht in ihr Aufblühen, in ihre volle Entfaltung, in das vollkommene Erscheinen ihres eigenen Wesens lichten, sondern sie zur Selbstvernichtung, zum Sturz in das Feuer verführen würde. „Wie Feuer ... tödlich liebend/Sind Gottes Stimmen" (II 149). "Nicht wollen am scharfen Strahle sie gerne mir blühen" (H2), wiewohl göttliche Gnade, indem sie den Menschen zügelt, ihm hilft, sich zu fassen, sein Maß zu finden, sich selbst zu zügeln, und ihm dabei die Furcht vor dem himmlischen Feuer - dies ist aber Furcht vor Selbstvernichtung aus allzugroßer Liebe – nimmt, seinem Mut Hilfen gibt, ihn aufrecht hält mit einem goldenen Zaun.
Die Menschen bedürfen der Schonung, nur langsam können sie an das Licht gewöhnt werden (vergl. Platos Höhlengleichnis). Nur in der Brechung des Andenkens, nur durch "Erdennacht gemlildert" (Klopstock, vergl. Binder a.a.0.S.359) vermag der Mensch die Herrlichkeit des Herrn zu ertragen. Das Andenken der Erdennacht aber geschieht durch die "Sage", durch die heilige Schrift ("Mittelbar/In heiligen Schriften" II 172). Die heiligen Schriften werden goldner Rauch genannt (H2). Der aufdampfende Morgennebel verbirgt den Glanz der aufgehenden Sonne, er lässt ihre vernichtenden Strahlen nicht hindurch, aber er wird durch sie golden. Die Kraft des Feuers leuchtet, doch das Leuchten ist still, weil es gemildert ist. Die unmittelbare Selbstoffenbarung Gottes ist ein versengendes Feuer, ein vernichtender Blitz, begleitet vom krachenden Donnerschlag. Der Blitz, der in der Ferne aufleuchtet, ist still, der Donner ertönt erst später. Dieser Blitz ist ein "stilles Zeichen": die Herrlichkeit Christi, vermittelt in Andenken der heiligen Schriften. In schonender Gnade, still, blickt der leuchtende Gott aus diesen heiligen .Schriften, so daß der Mensch im Lesen der Schriften sich an die unmittelbare Schau der Herrlichkeit gewöhnen kann. Dieser Glanz, diese still-leuchtende Kraft in heiligen Schriften wird verglichen mit dem Leuchten, das auf dem Gesicht eines von Gottes Herrlichkeit ergriffenen, die Welt vergessen habenden (oblitus) Sehers liegt. Er hat die Augenbrauen hochgezogen, seinen Augen glänzen weit offen, widerspiegelnd den Glanz Gottes. So wird der stille Blick
34) Gottes nur indirekt, noch einmal gebrochen, in dem Blick des Sehers sich spiegelnd, gedichtet. Direktes, feierndes Sagen ist nicht möglich.
Und wenn die Himmlischen jetzt
So, wie ich glaube, mich lieben,
Hölderlin ist selbst zum dichterischen, starken Menschen geworden. „Wenn jetzt der heilige Strahl den Dichter trifft, wird er nicht hineingerissen in die Glut des Strahls, sondern vollends zugekehrt dem Heiligen“ (67). Der Dichter hat das Heilige erkannt als die Schönheit (Harmonia), als die vollkommene Fügung des Gegensätzlichen. So fügt er sich dieser Fügung des heiligen Geschicks und anerkennt das Göttliche als die „höhere Sphäre“ und opfert (II 18o) ihm. Diese Anerkennung des anderen in seinem Eigenen aber ist die Voraussetzung der liebenden Vereinigung der Teile zum Ganzen, ist die Voraussetzung des Heiligen als des Einsseins im Getrenntsein. Der Dichter ist nicht mehr der „Unheilige“ (Lesart H1 zur 12. Strophe), sondern er ist demütig, dankend (II 49) geworden und stellt sich so bereit für die Vereinigung in Liebe, denn er hat das rechte Maß der Liebe erkannt und ist bewahrt vor einer aus Vermessenheit entstandenen allzugroßen Innigkeit, die die Unterschiede verwischen möchten. Denn der Geist der Liebe ist „der Wille, daß das Geliebte in sein eigenes Wesen finde und darin festbleibe“(118). „Jetzt“, wo er sich und die Himmlischen mißt mit dem Maße der Liebe, darf der Dichter annehmen, daß er frei geworden ist für das rechte Verhältnis zu dem Himmlischen und daß darum die Himmlischen ihn lieben. Denn auch die Götter stehen unter dem Wesensgesetz der μοǐρα, welches ist: „Die Liebe zum Unheimischen umwillen des Heimischwerdens im Eigenen“ (S.83). Heimisch sein im Eigenen heißt: in die volle Anwesenheit seiner Erscheinung treten, heißt erst eigentlich Sein. So haben die Himmlischen ihr Sein, indem in der Gemeinschaft der Liebe ihr Bedürfen gestillt ist, ein Bedürfen, welches entsteht aus der Notwendigkeit, sich nur in den Sterblichen fühlen, d.i. als die Himmlischen erkennen zu können. Zwar ist das jetzige Verhältnis der Liebe nur gegründet auf das Andenken, weil die Himmlischen nicht mehr auf der Erde sind und ihr Wesen mehr und mehr verblasst ist, sodass die Götter zwar an erkannt, ab er nicht in ihrer vollen Herrlichkeit erkannt werden, doch ist der Saal bereitet für die Feier des Brautfestes, bei der sich die Liebe vollendet. Hier, im Brautfest, ist die Einheit die lebendigste, die erscheinende Herrlichkeit die schönste, weil die Teile sich vollkommen als das je andere erkannt haben.
Wie viel mehr Dich,
Der Landgraf 35) ist angesprochen, ihm ist die Hymne gewidmet, er steht also in einem wesentlichen Bezug zu dieser Hymne, die das rechte Verhältnis von Göttern und Menschen klärt, damit die Klarheit des neuen Göttertages kommen kann. Im Landgrafen sieht der Dichter ein Bild des dichterischen Menschen überhaupt, des Einen, bei dem Menschliches unter Menschen noch gilt. Der Landgraf steht fest in der Tradition einer christlichen, andenkenden Gemeinde und ist nie den Versuchungen eines selbstherrlichen Menschentums erlegen. (Ein ganzes Leben lang hat er in Demut ausgeharrt.) Im Gegenteil, er betrachtet mit Sorge die Hybris seiner genialischen Zeitgenossen, die sich zum Gott aufschwingen möchten. Er hat die Gefahren eines solchen Menschentums erkannt und mag seine Befürchtungen bestätigt gefunden haben etwa im Werther, dieser Tragödie des entchristlichten, ganz auf sich selbst gestellten Menschen, dessen einzige Bindung sein Herz ist und den die „Grenzen der Menschheit drängen“ (HA VI 5o). So wendet sich der Landgraf an den Dichter des Messias, damit dieser „durch ein religiöses Gedicht dem Zerfall des Glaubens Einhalt tue“ (Hjb 1952 S.128). Hölderlin aber erinnert sich, daß er einmal der Versuchung des Reichtums erlegen ist und daß er wohl immer gefährdet bleibt, mit der schöpferischen Kraft des Wortes, des „gefährlichsten der Güter“ sich die Wahrheit verfügbar zu machen. Er hatte nicht sein ganzes Leben lang auf das Gesetz der Versöhnung gehört und kann sich deshalb mit dem Landgrafen nicht vergleichen.
Denn Eines weiß ich,
Daß nämlich der Wille
Des ewigen Vaters viel
Dir gilt.
Der dichterisch lebende Mensch hat den Willen des ewigen Vaters aufgenommem in seinen Willen, sodaß er sagen kann: „Doch kommt das, was ich will“ (II 243). Dieser Wille ist kein Wille zur Macht, der sich des Kommenden bemächtigen möchte, sondern ein Wille, der hört das verborgen anwesende Gesetz der „mächtigen ... Natur“. Und die Antwort, die der „dem Höchsten geeignete“ (III 47) Mensch auf dieses Gesetz der allversöhnenden Natur gibt, ist die wissende Bereitschaft für die Zugehörigkeit in das Geschick, das jedes sich ihm fügende in die Wahrheit seines Wesens schickt, somit der Vater aller Dinge ist, der allem Werden zugrunde liegende Grund, das Bleibende, das Ewige. Dieser ewige Grund trägt Züge des persönlichen Gottes des Christentums, so daß dieses Gesetz nicht blinde Notwendigkeit ist, sondern im Willen des Vaters liegt, den Christus als stilles Zeichen offenbarte.
Still ist sein Zeichen
Am donnernden Himmel. Und einer stehet darunter
Sein Leben lang. Denn noch lebt Christus.
„Denn unter allem, was ich schauen kann von Gott, ist dieses Zeichen mir das auserkorene geworden“ ( Brief 236). Der Blitz, tötend und belebend zugleich, ist Zeichen des Höchsten, auch zeigt er sichtbar das Gesetz, das(s?) nur im Beibehalten der Gegensätze wahrhaftes Sein möglich ist; der Blitz ist nur Blitz in seiner Einheit von Aufleuchten und Erlöschen und nur am Hintergrund der Nacht kommt er in die Erscheinung seines Wesens. Das Wesen des Höchsten offenbart sich, am herrlichsten in Christus, dem „Abglanz der Herrlichkeit des Herrn“ (Hebr.1,3). Doch die Sichtbarkeit dieses Glanzes muß sich entziehen, damit die Menschen, die unter dem Zeichen stehen, nicht vernichtet werden. So verbirgt sich das Zeichen des Höchsten im Andenken, in dessen Bergung Christus weiter lebt. Das Zeichen der Anwesenheit Gottes am donnernden Himmel ist gemildert, ist still, aber es ist nicht erloschen für den Menschen, denn der dichterisch lebende Mensch, der Eine, steht sein ganzes Leben lang darunter, er hält sich gebunden in seinen Grenzen und bildet mit Gleichgesinnten eine Gemeinde, und Christus lebt mitten unter ihnen. In dieser Stille, in dieser Ruhe kann der Mensch sich sammeln auf das Kommen des Brautfestes.
Wir haben bisher den Vers „Wie viel mehr Dich“ in seiner einfachen, direkten Aussage verstanden. Aber es klingt in ihm noch anderes an, nicht Ironie, aber doch ein leichtes Sich-Distanzieren. Der Dichter, der den griechischen und den christlichen Himmel miteinander versöhnen will, unterscheidet sich von dem bibelfrommen. Pietisten, der nur Christus kennt als sich verhüllende Offenbarung des Höchsten. In dieser Unterscheidung wird das „aber“ des folgenden Textes bedeutsam.
Es sind aber die Helden, seine Söhne,
Gekommen all und heilige Schriften
Von ihm und den Blitz erklären
Die Taten der Erde bis itzt,
Ein Wettlauf unaufhaltsam. Er ist aber dabei. Denn seine Werke sind
Ihm alle bewußt von jeher.
Der Landgraf sieht nur den einen Helden, Hölderlin sieht die Helden all, denn der Vater hat auch andere Söhne, er offenbart sich in den verschiedensten Gestalten. In vielen Zeichen offenbart sich der Grund als Geist und hält so das Andenken an ihn wach in der Nacht. Ja eigentlich sind alle Taten der Erde, die ganze Menschheitsgeschichte Zeichen des Grundes, einmal mehr, einmal weniger klar; das klarste und reinste Zeichen aber ist Christus.
In Natur und Geschichte offenbart sich Gottes Wirken, mehr noch: Natur und Geschichte sind Gottes Wirken, Gottes „Werke“: als schöpferischer Grund lässt er alles Seiende in seine leuchtende Erscheinung treten - Er ist aber dabei -, aber so, daß er erst im Durchgang durch das Gewirkte wird, was er ist. Der Grund als Ganzes muß sich differenzieren in seine Teile, um so in der Form höchster Bildung zu sich selbst zu kommen. Er ist bei seinen Werken, denn diese Werke sind ja Entfaltungen seiner selbst; und er weiß um diese Entfaltungen seiner selbst, mehr noch: weil der Grund Selbstbewusstsein ist, entfaltet er sich. Denn das Wissen des Absoluten um sich selbst ist der Grund des Entzweiung in die Besonderung: der absolute Geist, auf sich selbst reflektierend, setzt dabei zugleich mit der Position die Negation (Dialektik), so dass in der Reflektion ein ständiger Wandel des Subjekts sich vollzieht. Dieser Wandel ist das Werden in Natur und Geschichte. So verstehen wir im Sinne des Hegelschen Panlogismus das wörtliche Zitat aus der Apostelgeschichte (15,18): „Denn seine Werke sind /Ihm alle bewusst von jeher.“ In einem lebendigen Prozess entfaltet das Sein das, was es der Möglichkeit nach immer schon war, in die Wirklichkeit. Ist der absolute Geist am Ende dieses Prozesses ganz zu sich selbst gekommen (für sich), dann ist die Klarheit erreicht: das Einssein im Getrenntsein, die Versöhnung des Himmels und der Erde. Diesem Ziel eilt der absolute Geist vermittels seiner Besonderungen unaufhaltsam zu. Seine Besonderungen sind ein Wettlauf zu diesem τέλος hin. Auf diesem Wege zu sich selbst wird das Wehen des absoluten Geistes in einigen Kristallisationspunkten vornehmlich spürbar, etwa in philosophischen und religiösen Schriften im, Liede des Dichters.
In diesen Schriften weht das Heilige und so dürfen sie heilige Schriften genannt werden. Zu ihnen gehört auch die eine heilige Schrift, die des Christentums, die Hölderlin in der 13. Strophe nennt im Blick auf die christliche Gemeinde des Landgrafen.
Aber nicht nur in den Schriften und ihren Schriftstellern wehet der Geist, sondern in Gestalten der Geschichte („Gipfel der Zeit“, Hegel sah so Napoleon) und in den Gestalten der Mythologie, etwa in den Helden Homers. Auch sie sind Offenbarungen des Höchsten, auch sie sind wie die heiligen Schriften von ihm gekommen und erklären als die Taten der Erde den Blitz, nun selbst ein gemildeter Blitz. An der Spitze der Helden zwar steht Christus, der Schönste. Doch hat der Vater auch andere Söhne: In der Hyperionzeit schreibt Hölderlin über Achill: „Er ist mein Liebling unter den Helden, so stark und zart, die gelungenste und vergänglichste Blüte der Heroenwelt, ‚s o f ü r k u r z e Z e i t g e b o r e n’ nach Homer, eben weil er so schön ist.“ „In die Mitte gestellt zwischen „Altklugheit und Rohheit“ (IV 234) ist er Zeichen des ewigen, göttlichen Seins, und wie Christus ist er nur für kurze Zeit geboren, damit er die Menschen in ihr Eigenes weise und das Andenken hinterlasse an die kommende Versöhnung. Kerényi weist auf eine „Erlösungsmöglichkeit im griechischen Stil“ hin, ein Gedanke, „der sich nur an der Gestalt des Achilleus entzünden konnte“ (K. Kerényi, ‚Prometheus’ Rowohlts Deutsche Enzyklopädie S.. 115).
In eineren späteren Fassung der Patmoshymne wehrt Hölderlin den Versuch, Christus den antiken Helden gleichzusetzen, ab: „Das geht aber/Nicht“ (II 19o).
|