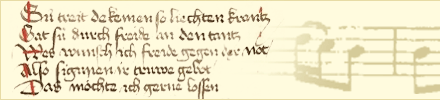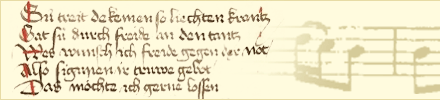|
|

Abitur Leistungskurs
Goethe, Faust I
Text: Reclam-Ausgabe
Aufgabenstellung:
Interpretieren Sie die vorgelegten Verse aus der Szene ‘Wald und Höhle’ und den Monolog Gretchens am Spinnrade!
Berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte:
a) die Besonderheit der Naturerfahrung, wie sie sich in ‘Wald und Höhle’ darstellt
b) die unterschiedlichen Reaktionen Fausts und Gretchens auf die Erfahrung der existentiellen Erschütterung durch die Liebe und die Gründe für diese Unterschiede
c) die Hinweise auf das tragische Ende und auf die Funktion Mephistos
d) die Übereinstimmung von Aussage und rhythmischer Gestaltung (Berücksichtigen Sie die Verse des Anfangs und die des Endes von ‘Wald und Höhle’ und auch die Verse Gretchens!)
Aufgabenstellung vom Dezernenten vorgeschlagen:
Interpretieren Sie die vorgelegten Verse aus der Szene ‘Wald und Höhle’ und den Monolog Gretchens am Spinnrad nach Gehalt und Form und vergleichen Sie die unterschiedlichen Reaktionen Fausts und Gretchens auf die Erfahrung der existentiellen Erschütterung durch die Liebe!
|
3220
3225
3230
3235
3240
3245
3250
3280
3285
3290
3295
3350
3355
3360
|
Wald und Höhle
FAUST allein.
FAUST. Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust,
Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen.
Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesenfichte stürzend Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift,
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert,
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber, schweben mir
Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch
Der Vorwelt silberne Gestalten auf
Und lindern der Betrachtung strenge Lust.
O dass dem Menschen nichts Vollkommnes wird,
Empfind ich nun. Du gabst zu dieser Wonne,
Die mich den Göttern nah und näher bringt,
Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr
Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech,
Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts,
Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt.
Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer
Nach jenem schönen Bild geschäftig an.
So tauml ich von Begierde zu Genuss,
Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde.
MEPHISTOPHELES tritt auf.
MEPHISTOPHELES. Habt Ihr nun bald das Leben gnug geführt?
Wie kann’s Euch in die Länge freuen?
Es ist wohl gut, dass man’s einmal probiert;
Dann aber wieder zu was Neuen!
[...]
FAUST. Verstehst du, was für neue Lebenskraft
Mir dieser Wandel in der Öde schafft?
Ja, würdest du es ahnen können,
Du wärest Teufel gnug, mein Glück mir nicht zu gönnen.
MEPHISTOPHELES. Ein überirdisches Vergnügen!
In Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und Himmel wonniglich umfassen,
Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsdrang durchwühlen,
Alle sechs Tagewerk im Busen fühlen,
In stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen,
Bald liebewonniglich in alles überfließen,
Verschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition - (mit einer Gebärde)
Ich darf nicht sagen, wie - zu schließen.
FAUST. Pfui über dich!
MEPHISTOPHELES. Das will Euch nicht behagen
Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen.
Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen,
Was keusche Herzen nicht entbehren können.
Und kurz und gut, ich gönn Ihm das Vergnügen,
Gelegentlich sich etwas vorzulügen;
[...]
FAUST. Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehauste?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh,
Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,
Begierig wütend, nach dem Abgrund zu?
Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen,
Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,
Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt.
Und ich, der Gottverhasste,
Hatte nicht genug,
Dass ich die Felsen fasste
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden musst ich untergraben!
Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muss geschehn, mag’s gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen
Und sie mit mir zugrunde gehn!
[...] |
|
zu 3217: ‚Erhabner Geist’ gemeint ist der Erdgeist.
zu 3219: ‚im Feuer’ - bei seinem ersten Erscheinen im Studierzimmer Fausts
zu 3238: ‚Der Vorwelt silberne Gestalten’ - In den vom Mond beschienenen Nebeln sieht Faust Gestalten der Vergangenheit.
zu 3279: ‘Wandel’ soviel wie ‘Sich-Aufhalten’ ‚Öde’ - einsame, abgelegene Gegend
zu 3291: ‚Intuition’ spontane Erkenntnis; unmittelbare Anschauung, auf Eingebung beruhend; ‚(mit einer Gebärde)’: Beischlaf andeutend
|
3375
3380
3385
3390
3395
3400
3405
3410
|
Gretchens Stube
GRETCHEN am Spinnrade, allein.
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Wo ich ihn nicht hab,
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.
Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus.
Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,
Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuss!
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn,
Und küssen ihn,
So wie ich wollt,
An seinen Küssen
Vergehen sollt! |
|
Erwartungen an die Interpretation
zu a)
Im Unterricht wurde der Erdgeist als Wirken der Natur, als das Leben schlechthin, in dem das Göttliche sich zeigt (Pantheismus), interpretiert; und Mephisto, vom Erdgeist gesandt, wurde gedeutet als ein notwendiger Bestandteil dieses Lebens. Zu Beginn dieser Szene empfindet Faust „das pantheistische Gefühl des Einsseins mit der Natur, die Erfahrung ihrer heilenden Kraft und das Vermögen, sich selbst durch innere Kommunikation mit der Natur wie der Menschenwelt, ja sogar mit 'der Vorwelt silberne Gestalten', zu erkennen“ (Hans Jaeger, ‘Der Wald- und Höhle’-Monolog im ‘Faust’, in: Aufsätze zu Goethes Faust I, ed. Werner Keller, Darmstadt, 1974).
Die Erscheinungen der Natur (Busch, Wasser usw. ) sind Brüder des Menschen und also die Menschen (die „geheimen, tiefen Wunder“ der eignen Brust; 3233) Teil der Natur. Das Besondere der Naturerfahrung Faustens ist selbst in der Parodie durch Mephisto zu erkennen: Als Teil einer göttlich durchwirkten Natur fühlt der Mensch sich als Teil des Göttlichen („den Göttern nah und näher“); und auch die Menschheitsgeschichte ist Teil dieser Natur („Vorwelt silberne Gestalten“; 3238).
So flieht Faust in die Ruhe und Abgeschiedenheit der Natur und gewinnt durch deren heilende Wirkung Selbsterkenntnis und - wenigstens vorübergehend - inneres Gleichgewicht.
Geborgen in der Höhle - also im Innersten der Natur - fühlt Faust sich auch sicher vor den zerstörerischen Gewalten der Natur („wenn der Sturm im Walde braust und knarrt“; 3228).
Da in der Forschung die Deutung, dass der ‘Erhabene Geist’ der Szene ‘Wald und Höhle’ und der Erdgeist nicht identisch seien und der Erdgeist bei seinem ersten Erscheinen tatsächlich andere Aspekte zeigt, ist es sinnvoll, mit der Erläuterung, dass es sich in ‘Wald und Höhle’ um den Erdgeist handelt, eine Interpretationshilfe zu geben.
zu b)
Der augenfälligste Unterschied ist der Ort der beiden Monologe: bei Faust die Natur, bei Gretchen die Kammer, in der sie bei ihrer Arbeit sitzt - also die kleine Welt, während Faust sich im Unendlichen zu Hause und geborgen fühlt. Zu dieser kleinen Welt gehört das volksliedhafte Singen bei der Arbeit. Entsprechend ihrer kleinen Welt reagiert Gretchen auf die Erfahrung der Liebe zu jemandem außerhalb ihrer Welt auch mit Sorge, ja sogar Angst; bei der Empfindung ihrer Liebe empfindet sie zugleich Verlust und Tod. Sie hat ihren Seelenfrieden verloren: „Mein Ruh' ist hin / Ich finde sie nimmer...“ (3374-3376), während Faust, zunächst überlegen-ruhig; dann nicht für sich, wohl aber für Gretchen fürchtet, dass er als der Unbehauste ihr Untergang sein wird.
zu c)
Das tragische Ende, das Gretchen vorausahnt, ergibt sich aus dem Wesen Fausts, dem Wesen des ‘Faustischen’, des Menschen, der nie zur Ruhe kommen kann und will, aus seiner Zerrissenheit zwischen dem Anspruch einer himmlischen Liebe, die auf Dauer angelegt ist, und der Unrast, die seine sinnliche Begierde zu immer Neuem treibt und die Harmonie mit der göttlichen Natur zerstört („Du gabst zu dieser Wonne,/Die mich den Göttern nah und näher bringt,/Mir den Gefährten...“), aus der Zerrissenheit aufgrund der beiden Seelen Fausts, wobei der durch Sinnlichkeit und Triebhaftigkeit charakterisierte Teil Fausts durch Mephisto repräsentiert wird (so jedenfalls wurde im Unterricht interpretiert), so dass der Text trotz des Auftretens des „Gefährten“ im Grunde ein Monolog bleibt - ein Dialog Faustens mit sich.
Faust spürt, dass er aufgrund dieser Zerrissenheit seine Liebe und das Leben Gretchens zerstören wird (Bild des Wasserfalls), wehrt sich aber nicht dagegen, sondern glaubt, dass das schlimme Ende mit der Notwendigkeit eines Naturereignisses kommen müsse und Gretchen unausweichlich ein „Opfer“ sein wird: „Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben!/.../Was muss geschehn, mag’s gleich geschehn!/Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen/Und sie mit mir zugrunde gehn!“(3361ff.)
zu d)
Die fünfhebigen Jamben ohne Reim (Blankvers) geben dem Gebet Faustens an den ‘Erhabenen Geist’ den ruhigen, gelassen und würdevoll wirkenden Rhythmus. Mit dem Erscheinen Mephistos endet die Gelassenheit und der Rhythmus der Verse wird unruhig, zerrissen; am auffälligsten wird dies durch die unterschiedliche Länge der Verse, durch die schwebende Betonung bei 3360ff. Bei Gretchen soll die Schlichtheit des Volksliedtons an Beispielen verdeutlicht werden.
|
 Klausur 'Straße II' / Einführung Klausur 'Straße II' / Einführung
|
 |
 |
 |
|